Aktuelle Informationen
29.9.2025: Das Portal „marktueberwachung.eu“ wurde komplett in den allgemeinen Kanzleiblog überführt.
8.7.2025: Das Portal „Rheinisches Ortsrecht“ wurde komplett in den allgemeinen Kanzleiblog überführt.
12.6.2025: Das Handelsblatt führt Rechtsanwalt Prof. Dr. Koch in seiner aktuellen Aufstellung „Deutschlands Beste Anwälte 2025“ für den Bereich „Gewerblicher Rechtsschutz“ und „Öffentliches Wirtschaftsrecht“ sowie Rechtsanwalt Neumann für den Bereich „Telekommunikationsrecht“ auf.
Neueste Beiträge
- Letzte Änderungen bei der Umsetzung der NIS-2-Richtlinie im BSIG 26. November 2025
- Cyber und resilient: das IT-Sicherheitsrecht im Überblick 20. November 2025
- Bundesnetzagentur startet Konsultation des Katalogs von Sicherheitsanforderungen nach § 167 TKG 5. November 2025
- Auf dem Weg zu einem Gesamtkonzept für die Kupfer-Glas-Migration: die Eckpunkte des Bundesdigitalministeriums 11. Oktober 2025
- Regulierungsrechtliche Aspekte der Agenda für zufriedene Schienenkunden 27. September 2025
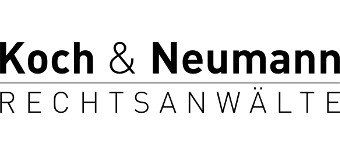
Eckpunkte des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung für eine umfassende Änderung des TKG
Netzwirtschaftsrecht, TelekommunikationsrechtAm 17. Juli 2025 hat das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) „Eckpunkte für ein Gesetz zur Änderung des TKG und zur Verbesserung der telekommunikationsrechtlichen Rahmenbedingungen für den TK-Netzausbau“ veröffentlicht. Worum geht es, was ist geplant und wie geht es weiter?
Weiterlesen
BVerwG: Entscheidung über Mitnutzung eines Leerrohrs
Netzwirtschaftsrecht, TelekommunikationsrechtIm Jahr 2016 ist das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) in Kraft getreten. Seitdem enthält das Telekommunikationsgesetz (TKG) mehrere Vorschriften, auf deren Grundlage Telekommunikationsunternehmen Bauarbeiten oder vorhandene Infrastruktur von Versorgungsunternehmen mitnutzen können, um schnelle Telekommunikationsnetze auszubauen. Während die Instanzgerichte – allen voran das Verwaltungsgericht (VG) Köln – bereits des Öfteren mit diesen Regelungen befasst waren, ist Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) hierzu bislang rar. Mit Beschluss vom 29. April 2025 (Az. 6 B 14.24) hat das Gericht nun einige umstrittene Fragen zu den Netzausbauvorschriften des TKG geklärt.
Weiterlesen
OLG Hamburg: Beginn der (anfänglichen) Laufzeit von Telekommunikationsverträgen
Netzwirtschaftsrecht, TelekommunikationsrechtEine der aktuell umstrittensten Fragen im 2021 novellierten Recht des Telekommunikationskundenschutzes betrifft den Zeitpunkt, zu dem die Laufzeit eines Vertrags über öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste beginnt. Denn davon hängt es unter anderem ab, ob die zeitliche Begrenzung auf zwei Jahre eingehalten wird, die sowohl § 56 Abs. 1 S. 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) als auch § 309 Nr. 9 lit. a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) vorgeben. Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) in Hamburg hat sich in seinem Urteil vom 19. Dezember 2024 (Az. 10 UKI 1/24) in dieser Frage nun klar positioniert und dabei eine (jedenfalls auf den ersten Blick) verbraucherfreundliche Haltung eingenommen.
Weiterlesen
Änderungen am Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit
Kostenrecht, ProzessrechtAm 1. Juli 2025 hat das Bundesverwaltungsgericht einen neuen Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit veröffentlicht. Der Streitwertkatalog ist auf dem Stand vom 21. Februar 2025 und löst den vorherigen Katalog aus dem Jahr 2013 ab. Doch was hat sich in diesen zwölf Jahren inhaltlich getan? Wir dokumentieren im Folgenden die Änderungen, die der neue Streitwertkatalog mit sich bringt.
Weiterlesen
Silvesterfeuerwerk zwischen Sprengstoffrecht und unerlaubter Sondernutzung
SondernutzungsrechtSeit einigen Jahren wird regelmäßig zum Jahresende darüber diskutiert, ob das klassische Silvesterfeuerwerk für Privatpersonen erlaubt oder wegen der mit ihm einhergehenden Beeinträchtigungen und Gefahren verboten werden sollte. Die Diskussion dreht sich dabei in erster Linie um gefahrenabwehr- bzw. sprengstoffrechtliche Aspekte. Bisher kaum diskutiert wurde demgegenüber die Frage, ob öffentliche Verkehrsflächen für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern genutzt werden dürfen. Zu Unrecht, wie im Folgenden dargestellt werden soll.
Weiterlesen
OLG Düsseldorf: kein wettbewerbsrechtlicher Erstattungsanspruch bei postrechtswidrig, aber bestandskräftig genehmigten Briefentgelten
Netzwirtschaftsrecht, Postrecht, WettbewerbsrechtIn einer aktuellen Entscheidung (Urt. v. 6.4.2022 – Az. U [Kart] 12/21, abgedruckt in N&R 2022, 248) hat sich das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf mit interessanten Fragen an der Schnittstelle zwischen dem allgemeinen Wettbewerbsrecht und dem sektorspezifischen Postrecht auseinandergesetzt. Es hatte insbesondere darüber zu befinden, unter welchen Voraussetzungen ein Rückzahlungsanspruch für gezahltes Briefporto wegen eines Verstoßes gegen das Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung von Marktmacht besteht. Eine besondere Note bekommt die Fallgestaltung dadurch, dass das marktbeherrschende Postunternehmen das Porto auf Grundlage einer Entgeltgenehmigung der Bundesnetzagentur erhoben hat. Diese Genehmigung hatte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) zwar höchstrichterlich für rechtswidrig erkannt. Gegenüber dem hier betroffenen Nachfrager ist sie aber in Bestandskraft erwachsen.
Weiterlesen
Corona-bedingte Kita-Schließungen und die Pflicht zur Zahlung von Elternbeiträgen
Abgabenrecht, Elternbeitragsrecht, OrtsrechtAls Reaktion auf die Corona-Krise ordnen die Landesregierungen vermehrt die Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen an. Das gilt seit Freitag, dem 13. März 2020, nun auch für das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen eines Maßnahmenpakets zur Eindämmung des Corona-Virus hat die Landesregierung die Schließung der Schulen beschlossen. Weiter hat sie angeordnet, dass Kinder im Alter bis zur Einschulung keine Kindertageseinrichtung mehr betreten dürfen. Lapidar heißt es in dem Maßnahmenpaket: „Die Eltern sind verpflichtet, ihre Aufgabe zur Erziehung der Kinder wahrzunehmen.“ Das stellt gerade berufstätige Eltern ganz unmittelbar vor nicht unerhebliche Herausforderungen. Dessen ungeachtet sind die Eltern aber auch oftmals verpflichtet, für die Inanspruchnahme eines Platzes in Kindertageseinrichtungen an die Kommunen Teilnahme- oder Kostenbeiträge, die sog. „Elternbeiträge“, zu entrichten. Dies gilt in aller Regel unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme der Betreuungsleistung. Haben die Corona-bedingten Kitaschließungen also zur Folge, dass die betroffenen Eltern nun die Betreuungsleistung selbst erbringen, aber trotzdem für die Bereithaltung des Kindergartenplatzes zahlen müssen? Die Antwort lautet: ja, aber.
Weiterlesen
Rechtsgrundlage der Corona-Quarantäne
Verfassungsrecht19.3.2020: Es gibt ein weiteres Update zu Ausgangssperren
13.3.2020: Es gibt ein weiteres Update zu Schul- und Kita-Schließungen
11.3.2020: Unten gibt es ein Update zum Verbot von Großveranstaltungen
Es herrscht Corona-Hysterie. In Supermärkten sind die Regale mit (Billig-) Nudeln und Toilettenpapier leergekauft – schließlich droht Corona-Quarantäne. Was bei all der Panik und Hysterie konsequent zu kurz kommt, sind Fakten. Als Rechtswissenschaftler und Anwalt will ich mich weiterer Kommentare zu Sinn und Unsinn der derzeit ergriffenen Maßnahmen – auch im Verhältnis zur jährlichen Grippewelle – enthalten. Hier sind Gesundheitsexperten gefragt. Dafür werde ich im Folgenden die rechtlichen Grundlagen einer Quarantäne näher beleuchten und dabei insbesondere den derzeit immer wieder geäußerten Fragen nachgehen: „Dürfen die das denn so einfach?“, „Reicht dazu ein Anruf?“, „Darf ich dann nicht einmal mehr mit dem Hund vor die Tür?“ und „Wie kann ich mich dagegen wehren?“ Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, ja, ja und einstweiliger Rechtsschutz beim zuständigen Verwaltungsgericht (bis zu einer Entscheidung dürfte sich allerdings die Quarantäne durch Zeitablauf erledigt haben …).
Weiterlesen
MacBook und iPad in der anwaltlichen Praxis
KanzleiorganisationVorbemerkung
Ich beschreibe im Folgenden meinen anwaltlichen Alltag und die von mir dabei genutzten Programme, Apps und Arbeitstechniken. Dabei bitte ich zu beachten, dass unsere Kanzlei insoweit eher untypisch ist, als wir nur wenige Mandanten in dafür regelmäßig sehr umfangreichen öffentlich-rechtlichen Verfahren vertreten. Fragen wie die nach einer effizienten Mandantenverwaltung oder einer leistungsfähigen Buchhaltung stellen sich bei uns nicht.
Weiterlesen
Wer muss in eine Durchbrechung des Fernmeldegeheimnisses einwilligen?
Datenschutzrecht, Telekommunikationsrecht, VerfassungsrechtAuf großes öffentliches Interesse traf im letzten Jahr ein Urteil des Berliner Kammergerichts vom 31. Mai 2017 (zum Az. 21 U 9/16). Das Gericht hatte zu entscheiden, ob Facebook in dem konkreten Fall den Eltern Zugang zum Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter gewähren muss. Die Entscheidung wirft eine Vielzahl sehr spannender Fragen auf, die verschiedene Rechtsgebiete berühren und die das Kammergericht in für Zivilgerichte nicht immer selbstverständlicher Ausführlichkeit abhandelt. Zahlreiche der ansprochenen Fragen sind auch aus Sicht des Telekommunikationsrechtlers interessant. Dazu zählt u. a. die Frage, ob eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses, also der Vertraulichkeit der Telekommunikation, bereits dann ausscheidet, wenn nur einer der beiden Kommunikationspartner mit der Offenlegung der Kommunikationsinhalte (oder Kommunikationsdaten) einverstanden ist, oder ob es der Einwilligung aller Beteiligten bedarf. Das Kammergericht hat sich für die letztgenannte Sichtweise entschieden (Rn. 104).
Weiterlesen