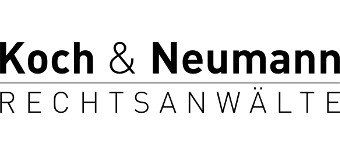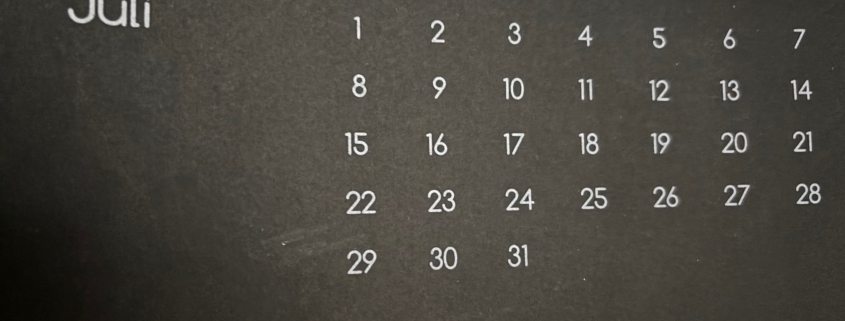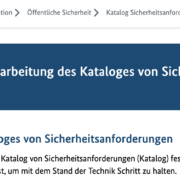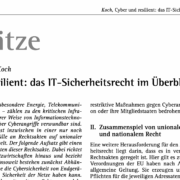OLG Hamburg: Beginn der (anfänglichen) Laufzeit von Telekommunikationsverträgen
Eine der aktuell umstrittensten Fragen im 2021 novellierten Recht des Telekommunikationskundenschutzes betrifft den Zeitpunkt, zu dem die Laufzeit eines Vertrags über öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste beginnt. Denn davon hängt es unter anderem ab, ob die zeitliche Begrenzung auf zwei Jahre eingehalten wird, die sowohl § 56 Abs. 1 S. 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) als auch § 309 Nr. 9 lit. a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) vorgeben. Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) in Hamburg hat sich in seinem Urteil vom 19. Dezember 2024 (Az. 10 UKI 1/24) in dieser Frage nun klar positioniert und dabei eine (jedenfalls auf den ersten Blick) verbraucherfreundliche Haltung eingenommen.
I. Telekommunikationsrechtlicher Hintergrund und Sachverhalt
Nach Abschluss eines Vertrags über die Erbringung von Telekommunikationsdiensten sind die Verbraucher während der Laufzeit des Vertrags grundsätzlich an die vereinbarten Konditionen gebunden. Das hat zum einen zur Folge, dass sie während dieser Zeit nicht von zwischenzeitlichen Verbesserungen der am Markt angebotenen Leistungen profitieren können.1 Und zum anderen stehen sie auch Wettbewerbern ihres Anbieters faktisch nicht als potentielle Kunden zur Verfügung.2 Von vertraglichen Bindungen gehen daher wettbewerbsdämpfende Wirkungen aus, die mit der Dauer der Vertragslaufzeit zunehmen.
§ 56 Abs. 1 S. 1 TKG sieht deshalb vor, dass die anfängliche Laufzeit eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste3 24 Monate nicht überschreiten darf. Darüber hinaus sieht § 309 Nr. 9 lit. a BGB vor, dass Regelungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam sind, die in Verträgen (unter anderem) über die regelmäßige Erbringung von Dienstleistungen eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags vorsehen. Letztgenannte Vorschrift gilt generell, also grundsätzlich für alle Branchen und Verträge.
In dem Sachverhalt, über den das OLG Hamburg zu entscheiden hatte, war in den AGB eines Glasfaseranbieters eine anfängliche Laufzeit (Mindestlaufzeit) von 24 Monaten vorgesehen. Weiter hieß es in den AGB: „Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Freischaltung des [Glasfaser-]Anschlusses des Kunden.“ Gegen die Kombination dieser Klausel mit der Mindestlaufzeit von 24 Monaten ging ein Verein, der satzungsgemäß unter anderem Verbraucherinteressen und -rechte durchsetzt, nach erfolgloser Abmahnung des Anbieters gerichtlich vor.
II. Entscheidung des OLG Hamburg
Das Oberlandesgericht prüfte die Klausel an der Vorgabe aus § 309 Nr. 9 lit. a BGB. Bei der regelmäßigen Erbringung von Telekommunikationsdiensten handele es sich um Dienstleistungen, so dass die hier relevanten Vertragsverhältnisse unter dieser Vorschrift fielen (Rn. 27). Die allgemeine Vorschrift des AGB-Rechts werde auch nicht von § 56 Abs. 1 TKG verdrängt, da beide Vorschriften parallel anwendbar seien (Rn. 28 ff.). Durch die Verknüpfung des Beginns der Vertragslaufzeit mit der Freischaltung des Anschlusses ermögliche die von dem beklagten Glasfaseranbieter verwendete Klausel eine länger als zwei Jahre bindende Laufzeit (hierzu und zum Folgenden Rn. 32 ff.). Die Klausel verstoße damit gegen § 309 Nr. 9 lit. a BGB. Die bindende Laufzeit beginne nämlich nicht erst mit der Leistungserbringung (Rn. 34), sondern mit dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Rn. 35 ff.). Die Vorschrift sei dabei auch nicht auf Erstverträge beschränkt, sondern gelte auch für Vertragswechsel (Rn. 39). Damit hat das OLG Hamburg drei bislang sehr umstrittene Fragen entschieden.
1. Nicht auf Erstverträge beschränkte Geltung
Eher am Rande hat es sich zu der Geltung von § 309 Nr. 9 lit. a BGB auch für Vertragswechsel geäußert. Das Gericht hat dabei die Auffassung vertreten, dass es zu Schutzlücken führen würde, griffe die gesetzliche Laufzeitbegrenzung nur für Erstverträge, da die Regelung die Kund:innen allgemein vor überlanger Vertragsdauer schützen solle (Rn. 39). AGB-rechtlich gibt es auch keinen greifbaren Anhaltspunkt dafür, dass die Laufzeitbegrenzung nur für Erstverträge gelten könnte4: § 309 Nr. 9 lit. a BGB bezieht sich generell auf eine „länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags“. Eine solche Laufzeit lässt sich nicht nur bei Erstverträgen, sondern auch bei Vertragsverlängerungen und -änderungen etwa bei einem Vertragswechsel feststellen.
Telekommunikationsrechtlich war die Frage jedoch sehr umstritten. Denn die dortige Laufzeitbegrenzung gilt nur für die „anfängliche Laufzeit eines Vertrages (§ 56 Abs. 1 S. 1 TKG). Insoweit lässt sich durchaus vertreten, dass es bei einer Vertragsverlängerung gerade nicht mehr um die „anfängliche“ Laufzeit des Vertrags geht, sondern um eine verlängerte Vertragslaufzeit. Auch § 56 Abs. 3 S. 1 TKG legt eine solche Differenzierung jedenfalls nahe. Dementsprechend haben einzelne Gerichte die Auffassung vertreten, dass § 56 Abs. 1 S. 1 TKG (bzw. die Vorgängerregelung in § 43b TKG 2012) verlängerten Vertragslaufzeiten keine Grenze setze.5 Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Frage 2023 noch für offen und klärungsbedürftig erachtet.6
In der Folgezeit haben allerdings mehrere Obergerichte die Anwendbarkeit auch auf Folgeverträge bzw. Vertragsverlängerungen, die nicht lediglich stillschweigend, sondern durch eine ausdrückliche Willenserklärung zustande gekommen sind, bejaht.7 Vor allem aber hat der Europäische Gerichtshof im Februar 2025 entschieden, dass sich die Richtlinienvorschrift, auf der § 43b TKG 2012 beruhte, auch auf die Laufzeit eines Folgevertrags bezieht und die Laufzeitbegrenzung damit insoweit ebenfalls gilt.8 Diese Entscheidung dürfte ohne weiteres auf die aktuelle Rechtslage übertragbar sein und daher auch die Auslegung von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG maßgeblich beeinflussen.9
2. Beginn der bindenden Laufzeit
Noch nicht ausdrücklich geklärt ist dagegen, auf welchen Zeitpunkt der Beginn der bindenden Laufzeit bezogen ist, für den die rechtliche Begrenzung gilt. Das OLG Hamburg hat sich nun in Bezug auf § 309 Nr. 9 lit. a BGB deutlich dafür ausgesprochen, dass es auf den Zeitpunkt ankomme, an dem der Vertrag – Erstvertrag oder Folgevertrag – abgeschlossen wird, auch wenn die Leistungserbringung selbst erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Das ist im Telekommunikationssektor jedenfalls bislang sehr praxisrelevant. Insbesondere gibt es drei Konstellationen, in denen der Beginn der Leistungserbringung – und damit auch der Zahlungspflicht – zeitlich herausgeschoben wird:
- Es sind technische Arbeiten erforderlich, um den Anschluss zu ermöglichen. Das betrifft beispielsweise Fälle, in denen ein Glasfasernetz noch bis zum Standort der Kunden:innen ausgebaut werden muss.10
- Der Vertrag wird vorzeitig verlängert, etwa unter Einräumung besserer Konditionen (höheres Datenvolumen, neues Endgerät und so weiter). In diesen Fällen wollen die Unternehmen bislang oftmals die bisherige Laufzeit um weitere 24 Monate verlängern, damit die Restlaufzeit des bestehenden Vertrags nicht verfällt.11
- Bei einem Anbieterwechsel vor Ablauf des bisherigen Vertrags will der neue Anbieter vermeiden, dass sich die Laufzeit des neuen Vertrags verringert, weil die Kund:innen bis zum Ende der Laufzeit des bisherigen Vertrags noch von dem betreffenden Anbieter versorgt werden.12
Das OLG Hamburg sah keinen Raum dafür, solche Besonderheiten des Telekommunikationssektors zu berücksichtigen. Denn bei § 309 Nr. 9 lit. a BGB handele es sich um ein Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit (Rn. 38): Ist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren vorgesehen, liegt unabhängig von den Gründen hierfür ein Verstoß gegen dieses Verbot vor. Entscheidend war also allein, wann die Laufzeit im Sinne der AGB-rechtlichen Vorgabe beginnt.
Dafür verwies das Oberlandesgericht auf ein Urteil des BGH aus dem Bereich der Stromlieferung (Rn. 36 f.): Danach gehe es darum, eine übermäßig lange Bindung der Kund:innen zu verhindern, die diese in deren Dispositionsfreiheit beeinträchtige. Die bindende Wirkung setze jedoch bereits mit dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses ein. Eine solche typisierende Betrachtung sei auch sachgerecht, da der Zeitpunkt des Vertragsschlusses regelmäßig feststehe. Wann die Leistungserbringung beginnt, könne demgegenüber zweifelhaft sein.
Diese Argumentation überzeugt zumindest wertungsmäßig für Fälle eines Erstvertrags, also für die oben unter 1. gefasste Konstellation. Hier würden die Kund:innen bei einem Abstellen auf den Beginn der Leistungserbringung tatsächlich über einen über zwei Jahre hinausgehenden Zeitraum in ihrer Dispositionsfreiheit beschränkt (und zugleich den Angeboten anderer Anbieter und dem Wettbewerb entzogen).
Nicht so klar ist die Situation dagegen bei vorzeitigen Vertragsverlängerungen, also in den unter 2. gefassten Konstellationen. Denn in diesen Fällen werden die Kund:innen in der Summe nur so lange gebunden, wie es rechtlich zulässig wäre: Der Erstvertrag hielte die Zwei-Jahres-Grenze genauso ein wie der unmittelbar daran anknüpfende Folgevertrag. Der Zeitraum, in dem sich die Bindung der Kund:innen noch aus dem bisherigen Vertrag ergibt, könnte dann bei der Berechnung der bindenden Laufzeit des Folgevertrags außer Betracht bleiben.
Aus telekommunikationsrechtlicher Sicht hat der EuGH einem solchen Verständnis zwar scheinbar eine Absage erteilt: Die Höchstgrenze von 24 Monaten gelte auch dann, wenn der Folgevertrag vor Ablauf des Erstvertrags unterzeichnet und in Vollzug gesetzt wurde.13 Im konkreten Fall hatte der Anbieter die anlässlich der Verlängerung vereinbarten Leistungsverbesserungen jedoch sofort umgesetzt und unter Anrechnung der noch nicht abgelaufenen Restlaufzeit des Erstvertrags eine 24 Monate überschreitende Vertragslaufzeit angegeben.14
Der EuGH hat seine Entscheidung insoweit nicht näher begründet, sondern nur formal auf die dann über 24 Monate hinausgehende Laufzeit des Folgevertrags abgestellt. Auch wenn wertungsmäßig kein relevanter Unterschied zu der Situation zu erkennen ist, in welcher die Leistungserbringung zu den verbesserten Konditionen und die Laufzeit des Folgevertrags erst mit Ablauf des bisherigen Vertrags beginnen soll, ist damit noch nicht völlig eindeutig, dass die Laufzeitbegrenzung auch in diesen Fällen bereits ab Vertragsschluss greift.15
Das gilt sogar noch mehr für die Frage, ob der Schutzzweck der Laufzeitbegrenzung auch die oben unter 3. geschilderten Konstellationen erfasst. Denn auch hier gibt es für den Übergangszeitraum eine „doppelte“ Bindung. Da Kund:innen in dieser Konstellation bis zum Ende der Laufzeit des bisherigen Vertrags ohnehin (rechtmäßigerweise) gegenüber ihrem bisherigen Anbieter gebunden sind, setzt die zusätzliche Beschränkung der Dispositionsfreiheit erst mit dem Beginn der Leistungsbereitstellung durch den neuen Anbieter ein. Jedenfalls mit Blick auf den Schutzzweck der Laufzeitbegrenzung ließe sich hier durchaus eine restriktive bzw. einschränkende Auslegung rechtfertigen, wonach die bindende Vertragslaufzeit bei einem Anbieterwechsel erst mit Beendigung der Bindung aus dem bisherigen Vertrag beginnt. Denn so würde es den Kund:innen ermöglicht, noch während der bestehenden Bindung von ihrer Dispositionsfreiheit für den Zeitraum nach Ablauf des bisherigen Vertrags in einer Weise Gebrauch zu machen, mit der die Bindung an den bisherigen Anbieter beendet wird.
In diese Richtung könnte auch der EuGH zu deuten sein, der in seiner Entscheidung – wenn auch veranlasst durch die Vorlagefrage – mehrfach betont hat, dass sie die Konstellation betrifft, in welcher der Folgevertrag „zwischen denselben Parteien“ wie der Erstvertrag geschlossen wird.16 Und auch das OLG Hamburg hat seine Entscheidung ausdrücklich von dem „speziellen Fall des Mobilfunk-Anbieterwechsels“ abgegrenzt (Rn. 37). Hier könnte also ggf. noch Klärungsbedarf bestehen. In seiner Rechtsprechung zu den Stromlieferverträgen, auf die sich das OLG Hamburg berufen hat, hatte der BGH jedoch gerade auch in den Fällen eines Anbieterwechsels den Beginn der bindenden Laufzeit des Vertrags bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses (und nicht erst mit Beginn der Leistungserbringung) gesehen.17
3. Verhältnis von § 309 Nr. 9 lit. a BGB und § 56 Abs. 1 S. 1 TKG
Gerade vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn versucht wird, die Entscheidungsgrundlage aus dem für alle Unternehmen geltenden AGB-Recht in das Telekommunikationsrecht zu verlagern. Denn dort ist möglicherweise Raum für eine Auslegung, die von der BGH-Rechtsprechung zur Laufzeitbegrenzung im AGB-Recht abweicht.
Allerdings hat das OLG Hamburg auch hier eine eindeutige Position bezogen: § 309 Nr. 9 lit. a BGB werde nicht durch § 56 Abs. 1 S. 1 TKG verdrängt (hierzu und zum Folgenden Rn. 28). Vielmehr komme die Vorschrift parallel zur Anwendung. Das sieht das Oberlandesgericht schon deshalb bestätigt, weil der BGH in einer Entscheidung aus dem Jahr 2021 einen Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste nicht nur an der telekommunikationsrechtlichen Vorschrift, sondern ohne weiteres auch an § 309 Nr. 9 lit. a BGB gemessen habe. Der BGH hat in dieser Entscheidung jedoch keinen Verstoß gegen die Laufzeithöchstgrenzen angenommen, weil jedenfalls keine zwei Jahr überschreitende Laufzeit vereinbart worden war 18. Mit der potentiell komplizierten Frage des Verhältnisses beider Vorschriften zueinander musste er sich daher überhaupt nicht auseinandersetzen.
In der Sache verneint das OLG Hamburg einen Vorrang von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG mit folgenden Argumenten: In den Gesetzesmaterialien gebe es keinen Hinweis auf einen solchen Vorrang (hierzu und zum Folgenden Rn. 29). Der Gesetzgeber habe vielmehr in Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben lediglich sicherstellen wollen, dass die Laufzeitbegrenzung auch für individualvertragliche Laufzeitvereinbarungen gilt, die nicht unter § 309 Nr. 9 lit. a BGB fallen. Auch Unionsrecht schließe es nicht aus, gegebenenfalls strengere Vorgaben – im AGB-Recht – vorzusehen (Rn. 30). Die mit dem Ausbau der Telekommunikationsnetze einhergehenden Besonderheiten rechtfertigten überdies keinen Ausschluss der AGB-Kontrolle, da § 56 Abs. 2 BGB ausdrücklich entsprechende Finanzierungsvereinbarungen erlaube (Rn. 31).
Diese Einschätzung ist nicht unangreifbar.19 Aus rechtsmethodischer Sicht besteht ein Vorrang der einen vor der anderen Norm unter anderem dann, wenn die eine Norm eine speziellere Regelung zu einem Sachverhalt enthält als die andere („lex specialis derogat legi generali“).
Eine solche Spezialität kann sich zunächst bereits formal anhand der gesetzlichen Tatbestände feststellen lassen: Enthält eine (speziellere) Vorschrift alle Tatbestandsmerkmale der anderen (allgemeinen) Vorschrift und ist durch ein zusätzliches Tatbestandsmerkmal logisch nur auf eine Teilmenge der von der allgemeineren Vorschrift erfassten Sachverhalte anwendbar, geht sie dieser allgemeinen Vorschrift (jedenfalls grundsätzlich) vor.
Eine solches formales Spezialitätsverhältnis dürfte hier nicht bestehen. Der Anwendungsbereich von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG ist zwar einerseits enger als der von § 309 Nr. 9 lit. a BGB. Denn er ist nicht auf Verträge über beliebige Dienstleistungen anwendbar, sondern nur auf Verträge über öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste. Andererseits ist der Anwendungsbereich von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG aber auch weiter, da er im Gegensatz § 309 Nr. 9 lit. a BGB nicht nur auf Regelungen in AGB anwendbar ist, sondern auch auf individualvertragliche Absprachen20.
Ein Spezialitätsvorrang kann aber auch jenseits einer formalen Spezialität bestehen, wenn sich aus Sinn und Zweck der einen (spezielleren) Vorschrift ergibt, dass sie abschließend die auch von der (anderen) Vorschrift erfassten Fälle regeln soll. Für ein solches inhaltliches Spezialitätsverhältnis spricht hier vieles.21
So bezeichnen die Gesetzesmaterialien zu § 43b S. 1 TKG 2012 die Vorschrift als „gesondert[e] und damit über § 309 Nummer 9a BGB hinausgehend[e] Regelung“.22 Es sollten danach also – bezogen auf den Bereich der Telekommunikationsdienste – die ansonsten von § 309 Nr. 9 lit. a BGB erfassten (AGB-) Sachverhalte und darüber hinausgehend noch weitere Fälle, nämlich individuelle vertragliche Vereinbarungen, erfasst werden. Das spricht dafür, dass der Gesetzgeber auch für AGB von der Anwendbarkeit von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG ausging, sofern Verträge über öffentliche Telekommunikationsdienste betroffen sein sollten.
Dann dürften Sinn und Zweck aber dafür sprechen, dass § 56 Abs. 1 S. 1 TKG für diesen Sachbereich als speziellere Regelung Vorrang vor § 309 Nr. 9 lit. a BGB beansprucht. Denn entweder ergeben sich aus beiden Vorschriften dieselben rechtlichen Grenzen für die Gestaltung einer Höchstlaufzeit.23 Dann besteht kein Bedürfnis für eine parallele Anwendung von § 309 Nr. 9 lit. a BGB. Oder im Rahmen von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG sind – unter Umständen auch unionsrechtlich induzierte – Besonderheiten des Telekommunikationssektors zu beachten. Dann hätte die parallele Anwendbarkeit von § 309 Nr. 9 lit. a BGB gespaltene Anforderungen an die Gestaltung einer Höchstlaufzeit zur Folge.
Davon geht letztlich auch das OLG Hamburg aus, wenn es auf die Möglichkeit hinweist, auf nationaler Ebene strengere Vorgaben vorzusehen als unionsrechtlich gefordert (Rn. 31). Dass der Gesetzgeber für individualvertragliche Vereinbarungen eine weniger strenge Regelung schaffen wollte als für die in der Praxis üblichen AGB-Produkte, ist den Gesetzesmaterialien aber nicht zu entnehmen. Vielmehr spricht angesichts der inhaltlichen Parallelen zwischen § 309 Nr. 9 lit. a und b BGB einerseits und § 56 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 S. 1 TKG andererseits viel dafür, dass die in den Gesetzesmaterialien für § 56 Abs. 3 S. 1 TKG explizit zum Ausdruck gebrachte Wertung auch auf § 56 Abs. 1 S. 1 TKG gilt:24 Danach sollte mit der telekommunikationsrechtlichen Vorschrift „eine spezialgesetzliche Regelung zu § 309 … BGB geschaffen“ werden.25
III. Ausblick
Das OLG Hamburg hat die Revision gegen sein Urteil zugelassen (Rn. 43 f.). Diese ist auch eingelegt worden und beim BGH unter dem Aktenzeichen III ZR 8/25 anhängig. Dabei dürfte viel dafür sprechen, dass der BGH in Bezug auf die Auslegung von § 309 Nr. 9 lit. a BGB bei seiner bisherigen Linie insbesondere aus dem Bereich der Stromlieferungsverträge bleiben wird. Offener erscheint jedoch die Frage, ob er überhaupt auf diese Vorschrift zurückgreifen oder den Fall stattdessen nicht ausschließlich nach Maßgabe von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG beurteilen wird.
Sollte der BGH die telekommunikationsrechtliche Vorschrift im Gegensatz zum OLG Hamburg für spezieller erachten und damit einen Rückgriff auf § 309 Nr. 9 lit. a BGB für ausgeschlossen halten, würde sich die Frage stellen, ob er § 56 Abs. 1 S. 1 TKG auch abweichende Maßstäbe in Bezug auf die Bemessung der Vertragslaufzeit entnimmt. Möglicherweise wird er diese Folgefrage verneinen, zumal er bereits – wenn auch eher im „Vorübergehen“ – entschieden hat, dass sich die Vorschriften inhaltlich entsprächen.26 Dann würde sich im Ergebnis voraussichtlich nichts ändern. Allerdings könnte es durchaus Anlass geben, den Beginn der bindenden Laufzeit im Telekommunikationssektor anders zu bestimmen als in anderen Bereichen.27
Zwar sind manche hierfür vorgebrachten Argumenten eher zweifelhaft. So weist das OLG Hamburg völlig zutreffend darauf hin, dass die einmaligen Kosten des (Glasfaser-) Netzausbaus zum Gegenstand besonderer Anschlussvereinbarungen gemacht werden können, die nach § 56 Abs. 2 TKG gerade nicht der Laufzeitbegrenzung des § 56 Abs. 1 S. 1 TKG unterliegen (Rn. 31).28 Und das Argument, dem zufolge im Falle eines Anbieterswechsels der neue Anbieter die Restlaufzeit des bisherigen Vertrags nicht kennt, übergeht den Umstand, dass diese ohne größeren Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann. Denn sowohl in den Rechnungen als auch in der jährlichen Information über den besten Tarif müssen nach § 4 S. 1 der Verordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt (TKTransparenzV) entsprechende Angaben enthalten sein. Es mag zwar sein, dass einige Kund:innen dennoch nicht in der Lage sein werden, diese Informationen bereitzustellen. Allein das dürfte es aber nicht rechtfertigen, hier das Kundenschutzniveau gegenüber § 309 Nr. 9 lit. a BGB (geringfügig) zu senken.
Demgegenüber führt die Möglichkeit, bereits vor Ablauf des bisherigen Vertrags einen neuen Vertrag anzubieten, zu einer Intensivierung des Wettbewerbs zugunsten der Verbraucher:innen, die auf diese Weise in den Genuss verbesserter Konditionen gelangen können. Könnten Anbieter in der Zeit vor Ablauf des bisherigen Vertrags neue Verträge nur unter Anrechnung der Restlaufzeit dieses Vertrags anbieten, müssten sie entstehende Fixkosten auf die so verringerte Laufzeit umlegen und würden auf diese Weise in ihren wettbewerblichen Möglichkeiten zulasten der Verbraucher:innen beschränkt.29
Es wurde bereits oben (unter II. 2.) gezeigt, dass der bisherigen Rechtsprechung des EuGH nicht zwingend zu entnehmen ist, ob sie entsprechenden vorzeitigen Angeboten des bisherigen Anbieters entgegensteht (Konstellation 2), sofern die einzelnen Verträge die Höchstlaufzeit von zwei Jahren jeweils nicht überschreiten. Jedenfalls ist aber zu berücksichtigen, dass der EuGH das Hauptziel der Laufzeitbegrenzung darin gesehen hat, „es Verbrauchern zu erleichtern, in voller Sachkenntnis den Anbieter zu wechseln, wenn dies in ihrem Interesse ist, damit die Verbraucher in den vollen Genuss der Vorteile eines wettbewerbsorientierten Umfelds kommen können“.30 Würde man auch bei einem vorzeitigen Vertragsschluss mit einem neuen Anbieter (Konstellation 3) den Beginn der Vertragslaufzeit auf den Moment des Vertragsschlusses beziehen, würden entsprechende Akquisemethoden und damit Anbieterwechsel erschwert.31
Und auch im Fall des Netzausbaus (Konstellation 1) kann es aus telekommunikationsrechtlicher Sicht sinnvoll sein, den Beginn der Laufzeit erst auf den Zeitpunkt der erstmaligen Leistungsbereitstellung zu beziehen. Zwar wäre das nicht erforderlich, um die einmaligen Kosten des Netzausbaus zu refinanzieren. Diese wären vielmehr, wie bereits dargelegt, über eine vom Dienstvertrag getrennte Anschlussvereinbarung zu decken. Aber da der Netzausbau gerade auch in der Erwartung der Akquise neuer Kund:innen erfolgt, würden entsprechende Anreize gedämpft, wäre bei der Bemessung der erstmaligen Vertragslaufzeit der Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Ausbau des Netzes bis zum betreffenden Standort (als notwendige Voraussetzung der Leistungsbereitstellung) zu berücksichtigen. Die Dispositionsfreiheit der betreffenden Kund:innen wäre zwar schon in diesem Zeitraum beschränkt. Dies würde jedoch unter Umständen nicht so schwer wiegen, da sie mangels Anbindung an das Netz in diesem Zeitraum überhaupt nicht in der Lage wären, entsprechende Leistungen zu beziehen, auch nicht von Dritten. Hierbei handelt es sich um eine Besonderheit netzgestützter Dienstleistungen, die ein von den allgemeinen Vorschriften abweichende Regelung rechtfertigen könnte.
Ob all das ausreicht, um die Vertragslaufzeit im Anwendungsbereich von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG anders zu bemessen als nach § 309 Nr. 9 lit. a BGB, ist eine spannende Frage. Es wäre wünschenswert, dass der BGH sie entscheidet, ggf. nach Einholung einer Vorabentscheidung des EuGH zu den unionsrechtlichen Grundlagen.32 Sollte der BGH die Frage am Ende verneinen, wird die Vertragspraxis hierauf reagieren müssen. So könnte etwa an die Einräumung eines voraussetzungslosen Kündigungsrechts bis zum Beginn der Leistungsbereitstellung zu denken sein, mit dem die von der Rechtsprechung adressierte Bindung durch eine Beschränkung in der Dispositionsfreiheit aufgehoben würde.
Update, 15.7.2025, 13:30 Uhr: Parallel zur Veröffentlichung dieses Beitrags hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. eine Pressemitteilung zu einer aktuellen Entscheidung des BGH in einem anderen Revisionsverfahren veröffentlicht. Daraus ergibt sich, dass auch nach Auffassung des BGH die Vertragslaufzeit auch nach Verlängerung nicht mehr als 24 Monate betragen darf. Es sei daher unzulässig, wenn Anbieter Verbraucher:innen durch vorzeitige Vertragsverlängerungen in Verträge mit über 24 Monaten Laufzeit bringen. Ob und in welcher Weise sich der BGH dabei zu anderen der in diesem Beitrag aufgeworfenen Fragen geäußert hat, ist derzeit noch nicht ersichtlich. Auf der WWW-Seite des BGH war zu dem Verfahren (zum Az. III ZR 61/24) bislang noch nichts zu finden.
Fußnoten
- Neumann, Telekommunikationsrecht kompakt, Bd. 2, 2023, S. 56.
- Neumann, a. a. O., S. 56.
- Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass der Vertrag nur nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste – wie E-Mail oder die meisten Messenger-Dienste – oder Übertragungsdienste für die Bereitstellung von Diensten der Maschine-Maschine-Kommunikation zum Gegenstand hat.
- A. A. allerdings OLG Köln, Urt. v. 28.5.2021 – Az. I-6 U 160/20, Rn. 99 ff. (NRWE)
- OLG Köln, Urt. v. 28.5.2021 – Az. I-6 U 160/20, Rn. 118 (NRWE); LG Bonn, Urt. v. 1.12.2020 – Az. 11 O 31/20, Rn. 94 (NRWE).
- BGH, Urt. v. 2.2.2023 – Az. III ZR 63/22, Rn. 43 ff.
- KG, MMR 2024, 959, 960 Rn. 28, 30 und 32 = CR 2024, 551, 552 f. (Urt. v. 22.5.2024 – Az. 23 UKI 1/24); OLG Düsseldorf, Urt. v. 31.3.2022 – Az. I-20 U 71/21, Rn. 47 ff. (NRWE)
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82, Rn. 32 ff. (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.
- Kiparski, CR 2025, 331, 332 Rn. 5.
- Fischer/Issels, K&R 2025, 270; Kiparski, CR 2025, 331, 331 Rn. 2.
- Kiparski, CR 2025, 331, 331 Rn. 1.
- Vgl. Kiparski, CR 2025, 331, 331 Rn. 2.
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82, Rn. 38 (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82, Rn. 15 (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.
- In diese Richtung auch Kiparski, CR 2025, 331, 332 Rn. 6.
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82, Rn. 30, 32, 33, 38 (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.
- Siehe etwa BGH, Urt. v. 12.12.2012 – Az. VIII ZR 14/12, Rn. 22 (juris).
- BGH, Urt. v. 18.11.2021 – Az. I ZR 106/20, Rn. 76.
- A. A. wohl Fischer/Issels, K&R 2025, 270, 271.
- Kiparski, CR 2025, 331, 333 Rn. 12.
- Kiparski, CR 2025, 331, 333 f. Rn. 12 f.; Neumann, a. a. O., S. 57.
- Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 17/5707, 43, 65 (zu Nr. 34 [§ 43b]).
- In diese Richtung deutet es, wenn der BGH darauf hinweist, dass die „Regelung des § 309 Nr. 9 Buchst. a BGB … inhaltlich § 43b Satz 1 TKG [2012]“ entspricht, also der Vorgängerregelung von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG, siehe BGH, Urt. v. 18.11.2021 – Az. I ZR 106/20, Rn. 74.
- Kiparski, CR 2025, 331, 333 Rn. 14.
- Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 19/26108, 200, 288 (zu § 56 Abs. 3).
- BGH, Urt. v. 18.11.2021 – Az. I ZR 106/20, Rn. 74.
- So ausführlich Kiparski, CR 2025, 331, 334 Rn. 18 ff.
- Neumann, a. a. O., S. 58 f.; verständliche Bedenken hinsichtlich der Akzeptanz einer solchen Praxis bei Fischer/Issels, K&R 2025, 270, 272; Kiparski, CR 2025, 331, 335 Rn. 22.
- Vgl. Kiparski, CR 2025, 331, 331 Rn. 1, 335 Rn. 23, sowie allgemein auch Sassenberg, BB 2012, 1295, 1296.
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82, Rn. 33 (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.
- Kiparski, CR 2025, 331, 335 Rn. 23.
- Ähnlich auch Fischer/Issels, K&R 2025, 270, 272.