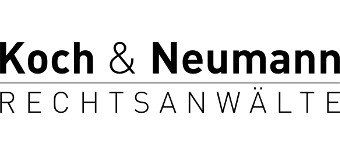Regulierungsrechtliche Aspekte der Agenda für zufriedene Schienenkunden
Am 22. September 2025 hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder seine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ vorgestellt.1 Sie formuliert Eckpunkte zur Reform der Deutschen Bahn (DB) und gibt der DB AG fünf Hauptziele vor: spürbare Zuverlässigkeit, dauerhafte Wirtschaftlichkeit, mehr Gemeinwohl, schnelle Umsetzung und wirksame Steuerung.2 Die Agenda ruht dabei auf drei Säulen: Reformen bei der DB, Maßnahmen des Bundes und Aktivierung des gesamten Sektors.3 Alle drei Säulen enthalten Bausteine, die sich auf Elemente der eisenbahnrechtlichen Regulierung beziehen. Diese sollen im Folgenden zusammengefasst werden.
I. Reformen bei der DB (1. Säule)
Die DB ist ein vertikal integrierter Konzern. Hiervon spricht man, wenn ein Konzern sowohl Vorleistungen anbietet, deren Bezug notwendig ist, um auf einem nachgelagerten Endkundenmarkt tätig zu sein, als auch selbst auf diesem Endkundenmarkt als Anbieter auftritt. Vertikale Integration ist insbesondere im Bereich von Netzinfrastrukturen, die nur mit großem Aufwand oder sogar überhaupt nicht wirtschaftlich dupliziert werden können, ein wettbewerbliches Problem.
Denn hier sind wegen des in wichtigen Bereichen monopolähnlichen Charakters des Netzes Wettbewerber auf dem Endkundenmarkt darauf angewiesen, dass sie auf Vorleistungsebene Zugang zu dem Netz des vertikal integrierten Konzerns bekommen. Der vertikal integrierte Betreiber der Netzinfrastruktur hat aufgrund der Zugehörigkeit zum selben Konzern aber grundsätzlich ein wirtschaftliches Interesse daran, das auf dem Endkundenmarkt tätige Konzernunternehmen beim Zugang zur Infrastruktur gegenüber seinen dortigen Wettbewerbern zu bevorzugen. Für diese ist dann kein chancengleicher Wettbewerb mit dem vertikal integrierten Konzern möglich.
Das Netzwirtschaftsrecht reagiert auf dieses Problem einerseits mit Diskriminierungsverboten, andererseits mit Maßnahmen der sog. Entflechtung. Hinter der Entflechtung steht der Gedanke, dass der Interessengleichlauf und das Diskriminierungspotential durch eine gewisse Herauslösung des Infrastrukturbereichs aus dem vertikal integrierten Konzern verringert werden können. Eine solche Entflechtung kann sehr weitgehend sein und die vertikale Integration sogar komplett aufheben. Das ist etwa der Fall, wenn es Personen, die einen Infrastrukturbetreiber kontrollieren, verboten wird, zugleich ein Unternehmen zu kontrollieren, das auf dem nachgelagerten Endkundenmarkt tätig ist. Ein Beispiel für eine derartige strenge eigentumsrechtliche Entflechtung findet sich in § 8 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Sie hebt die zuvor bestehende Einbindung des Infrastrukturbetreibers in den vertikal integrierten Konzern faktisch auf.4 Die Entflechtung kann aber auch eine deutlich geringere Intensität aufweisen.
Das betrifft auch den Eisenbahnsektor in Deutschland. Die §§ 8 ff. des Eisenbahnregulierungsgesetzes (ERegG) sehen zwar einige Vorgaben zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Betreibers der Eisenbahninfrastruktur im vertikal integrierten Konzern vor. Sie stehen seiner Einbindung in einen solchen Konzern aber auch nicht grundsätzlich entgegen. Es verbleiben daher Diskriminierungsanreize im Verhältnis zu konzernexternen Eisenbahnverkehrsunternehmen.5 Gerade auch die Monopolkommission fordert daher seit langem eine vollständige eigentumsrechtliche Entflechtung der DB oder jedenfalls weitergehende strukturelle Maßnahmen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der DB InfraGO AG als des konzernzugehörigen Infrastrukturunternehmens.6
Der nun vorgestellten Agenda zufolge soll der zweitgenannte Weg (weiter) beschritten werden. Das soll in vier Schritten geschehen7 Alle diese Schritte dürften, soweit ersichtlich, DB-intern umgesetzt werden, zum Teil unter Einbindung des Bundesverkehrsministeriums. Eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften dürfte hierfür also weder erforderlich noch geplant sein.
1. Transparenz
Es soll transparenter gemacht werden, dass die Gewinne der DB InfraGO AG in ihren eigenen Finanzierungskreislauf zurückfließen. Durch einen solchen Mittelrückfluss wird sichergestellt, dass die Einnahmen aus den Trassenentgelten, die von den Eisenbahnverkehrsunternehmen der DB InfraGO AG für die Nutzung des Schienennetzes gezahlt werden, ausschließlich der Infrastruktur zugutekommen. Sie können dann insbesondere nicht zur Quersubventionierung der DB-eigenen Eisenbahnverkehrsunternehmen verwendet werden. Ab 2026 soll dieser Kreislauf durch unabhängige Jahresabschlussprüfer analysiert und testiert werden. Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen in geeigneter Form veröffentlicht werden.
2. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
Der bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der DB InfraGO AG und der Konzernholding DB AG soll überprüft werden. Dieser Vertrag erlaubt in gewissen Grenzen einen Durchgriff des Konzerns auf Entscheidungen des Infrastrukturbetreibers und wird deshalb gerade auch von der Monopolkommission regelmäßig kritisiert.8 Die Agenda sieht nun vor, dass der Fortbestand dieses Vertrags überprüft werden und hierüber in der ersten Jahreshälfte 2026 endgültig entschieden werden soll. Flankierend soll die Satzung der DB AG noch 2025 dahingehend geändert werden, dass der Aufsichtsrat der DB AG wesentlichen Weisungen des Vorstands der DB AG und der Wahrnehmung von Aktionärsrechten, die Auswirkungen auf die DB InfraGO AG haben, künftig zustimmen muss.
3. Wahrnehmung infrastrukturbezogener Aufgaben
Überprüft werden soll ferner die bisherige Praxis, bestimmte infrastrukturbezogene Aufgaben wie etwa den Einkauf oder die politische Kommunikation nicht durch die DB InfraGO AG selbst, sondern durch den Konzern wahrzunehmen. Ein entsprechender Bericht soll bis Ende 2026 vorgelegt und seine Ergebnissen sollen dann konsequent umgesetzt werden. Das Bundesverkehrsministerium erwartet darüber hinaus, dass bereits kurzfristig der DB Navigator einschließlich der damit verbundenen Internetpräsenz in die Verantwortung der DB InfraGO AG übertragen werden. Zuletzt fiel der DB Navigator in den Verantwortungsbereich der DB Fernverkehr AG. Die auf den Endkundenmärkten selbst tätige Fernverkehrstochter der DB AG hat also derzeit die Kontrolle über die in der Praxis sehr verbreitete Plattform für die Suche und Buchung von Zugverbindungen für Endkunden.
4. Weitere personelle Entflechtung
Die personelle Entflechtung soll vorangetrieben werden. Hierzu soll der auf Konzernebene bisher bestehende Posten eines Vorstands für Infrastruktur abgeschafft werden. Hierdurch werden die Position des Vorstandsvorsitzenden der DB InfraGO AG und damit die Unabhängigkeit des Infrastrukturbetreibers gestärkt.
II. Maßnahmen des Bundes (2. Säule)
Die Maßnahmen, die der Bund selbst ergreifen will, um für zufriedene Kunden auf der Schiene zu sorgen, werden auch gesetzliche Vorhaben umfassen.9 Das umfasst zum einen die Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsprozesse, eine Reform der Eisenbahnverkehrsverwaltung (mit für 2027 geplanten Eckpunkten) und eine Weiterentwicklung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG). Zum anderen ist aber auch die eisenbahnrechtliche Regulierung im engeren Sinne betroffen, die durch zwei Maßnahmen ebenfalls vereinfacht und beschleunigt werden soll:
1. Reform der Regelungen für die Trassenentgelte
Die Regelungen für die Trassenentgelte sollen bis zum 1. Januar 2027 reformiert werden. Ziel ist eine Senkung der Trassenpreise der DB InfraGO AG und in diesem Rahmen auch eine Unterstützung der Anbindung des ländlichen Raums. Hintergrund dieser Reformüberlegungen dürften drei aktuelle rechtliche Entwicklungen in Bezug auf die Regulierung der Trassenpreise sein.
Diese betreffen, erstens, insbesondere die Eigenkapitalverzinsung der DB InfraGO AG, die auch über die Höhe der Trassenentgelte erfolgt. Hierüber wird der Umstand abgegolten, dass die DB InfraGO AG ihr Vermögen durch die Errichtung und den Betrieb des Schienennetzes den Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Verfügung stellt, statt es anderweitig gewinnbringend einzusetzen. Zu einem aktuellen Problem ist das durch eine Änderung der Finanzierungssystematik im Bereich der Schienenwege geworden. Früher hat der Bund zur Finanzierung des Ausbaus und der Erhaltung des Schienennetzes so genannte Baukostenzuschüsse gezahlt. Diese unterlagen grundsätzlich als Ausgaben des Bundes der Schuldenbremse nach Art. 115 Abs. 2 des Grundgesetzes (GG). Um sich hier zusätzlichen Handlungsspielraum zu schaffen, ist der Bund deshalb dazu übergangen, der DB InfraGO die Mittel für die Infrastruktur stattdessen über die Zuführung zusätzlichen Eigenkapitals zur Verfügung zu stellen.10 Als finanzielle Transaktion wäre eine solche Mittelzuführung nicht als schuldenbremsenrelevante Ausgabe zu qualifizieren.11
Da hierdurch aber das – von Gesetzes wegen über die Trassenentgelte zu verzinsende – Eigenkapital erhöht wurde, hat dies zu einer deutlichen Erhöhung der Trassenentgelte geführt. Konkret hat sich die von den Eisenbahnverkehrsunternehmen zu finanzierende Eigenkapitalrendite hierdurch von 2022 bis 2024 von 562 Millionen Euro auf 1,021 Milliarden Euro fast verdoppelt.12 Die Bundesnetzagentur hat versucht, diese Konsequenz abzumildern, indem sie zur Bestimmung der über die Trassenentgelte zu finanzierenden Eigenkapitalrendite nicht den kapitalmarktüblichen Zinssatz zugrunde gelegt hat. Stattdessen hat sie auf die niedrigere tatsächliche Renditeerwartung des Bundes als des (mittelbarem) Eigentümer abgestellt.13 Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln aber für rechtswidrig erachtet und eine Berechnung anhand des (höheren) kapitalmarktüblichen Zinssatzes angemahnt.14 Die Bundesregierung hat hierauf bereits reagiert und den Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes15 vorgelegt. Mit dem Gesetz soll sichergestellt werden, dass bei der Regulierung der Trassenentgelte der bei der DB InfraGO AG anzusetzende Eigenkapitalzinssatz künftig der tatsächlichen Renditeerwartung des Bundes entspricht. Hiermit kann der Anstieg der Trassenentgelte gedämpft werden. An dem grundsätzlichen Problem steigender Trassenentgelte aufgrund der neuen Finanzierungssystematik ändert sich jedoch hierdurch nichts.
Hinzu kommt, zweitens, dass der Versuch des Gesetzgebers, diesen Anstieg für den Bereich des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) zu bremsen, ebenfalls auf gerichtlichen Widerstand gestoßen ist. In § 37 Abs. 2 ERegG ist nämlich vorgesehen, dass (auch) die Trassenentgelte für den SPNV nur so stark steigen dürfen wie die vom Bund insgesamt für den SPNV zur Verfügung gestellten Gelder, die so genannten Regionalisierungsmittel. Man spricht insoweit von einer „Trassenpreisbremse“.16 Das VG Köln hat in diesem Regelungsansatz einen Verstoß gegen unionsrechtliche Vorgaben gesehen und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klärung gebeten.17 Sollte sich der EuGH der Einschätzung des VG Köln anschließen, drohen erhebliche Anstiege der Trassenentgelte für den SPNV – wohingegen die Trassenentgelte für den Schienengüterverkehr und den Schienenpersonenfernverkehr abgesenkt werden könnten.
Zu guter Letzt spricht, drittens, eine aktuelle Entscheidung des EuGH18 sehr stark dafür, dass über die Trassenentgelte keine Eigenkapitalverzinsung erfolgen darf.19 Das könnte dafür sprechen, die gesamten Fixkosten, die der DB InfraGO AG durch die Errichtung und den Erhalt des Schienennetzes entstehen, perspektivisch vollständig durch Bundesmittel zu finanzieren.20 Jedenfalls aber ergäbe sich hieraus weiterer – fundamentaler – Reformbedarf in Bezug auf die Regelungen des ERegG zu den Trassenentgelten.
2. Anpassungen des Eisenbahnregulierungsrechts
Auch darüber hinaus soll das Eisenbahnregulierungsrecht „sachgerecht“ angepasst werden. Zu Recht wird in der Agenda für zufriedene Schienenkunden auf das laufende Rechtssetzungsverfahren für eine EU-Kapazitätsverordnung verwiesen.21 Diese dürfte Teile der Regelungen des ERegG zur Kapazitätszuweisung hinfällig machen.22 Das Bundesverkehrsministerium kündigt auch vor diesem Hintergrund an, eine neue Arbeitsgruppe „Deregulierung“ einzusetzen, um das Eisenbahnregulierungsrecht zu vereinfachen.
III. Aktivierung des gesamten Sektors (3. Säule)
Zu guter Letzt soll der Eisenbahnsektor insgesamt zu Verbesserungen beitragen.23 Das soll insbesondere durch eine verstärkte Zusammenarbeit erreicht werden. Hierfür soll eine befristete Taskforce „Zuverlässige Bahn“ gegründet werden. In dieser sollen der Bund, die Länder, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, das Eisenbahn-Bundesamt, die Bundesnetzagentur, die Aufgabenträger des SPNV, die Gewerkschaften sowie die DB InfraGO AG ein gemeinsames Paket für schnell wirksame Verbesserungsmaßnahmen erarbeiten. Auch soll der Sektorbeirat, ein aus der Bahnbranche besetztes unabhängiges Fachgremium, das die DB InfraGO AG und das Bundesverkehrsministerium berät, gesetzlich verankert und so als unabhängiges Expertengremium weiter gestärkt werden.
Die eisenbahnrechtliche Regulierung ist dann schließlich mit der dritten Maßnahme dieser Agendasäule angesprochen: Das Bundesverkehrsministerium erwarte, dass die DB InfraGO AG „einen fairen und diskriminierungsfreien Wettbewerb auf der Infrastruktur des Bundes ermöglicht, insbesondere durch Gleichbehandlung beim Zugang und den Entgelten“. Welche konkreten Schritte mit dieser Erwartung verknüpft sind, bleibt dunkel. Unklar ist auch, welchem Zweck es dient, dass das Ministerium diese Erwartung zum Ausdruck bringt. Denn die DB InfraGO AG ist schon von Gesetzes wegen zu einer fairen und diskriminierungsfreien Bereitstellung des Schienennetzes verpflichtet (§ 10 Abs. 1 S. 1, § 11 Abs. 1 ERegG). Die nun geäußerte Erwartung sollte es aber zumindest ausschließen, dass die in der 2. Säule angekündigte Arbeitsgruppe zur Deregulierung zu einem materiellen Abbau der eisenbahnrechtlichen Regelungen zur Sicherstellung eines fairen und diskriminierungsfreien Wettbewerbs führt.
IV. Fazit
Das Bundesverkehrsministerium hat sich mit seiner Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene einiges vorgenommen. Das wird auch Auswirkungen auf die eisenbahnrechtliche Regulierung haben. Vieles bleibt hier zwar noch eher vage und im Ungefähren. Zu begrüßen ist es jedenfalls, dass die DB InfraGO AG – wenn auch eher behutsam – weiter entflochten werden soll. Das wird die diskriminierungsfreie Leistungsbereitstellung und damit einen chancengleichen Wettbewerb auf der Schiene stärken. Von der ebenfalls angekündigten Reform der Regelungen der Trassenpreise können unter Umstände weitreichende Impulse für eine stärkere Nutzung der Schienenwege ausgehen, etwa wenn der bisherigen Vollkostendeckungsansatz aufgegeben oder eingeschränkt werden sollte. Hier wird aber die weitere Entwicklung abzuwarten sein. Das gilt auch für die angekündigte „Deregulierung“. Ein Abbau der regulierungsrechtlichen Vorgaben könnte zumindest potentiell dazu führen, dass die Risiken für einen fairen und diskriminierungsfreien Wettbewerb auf dem Schienennetz wieder zunehmen. Das stünde allerdings im Widerspruch zu der gegenteiligen Erwartung des Bundes. Es bleibt daher abzuwarten, wie die Weichen für das Eisenbahnregulierungsrecht dann tatsächlich gestellt werden.
Fußnoten
- Bundesministerium für Verkehr, Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene, 9/2025.
- Bundesministerium für Verkehr, a. a. O., S. 10 und 16 f.
- Bundesministerium für Verkehr, a. a. O., S. 11 f.
- Mohr, N&R 2025, 220, 228.
- Ausführlich dazu Monopolkommission, 8. Sektorgutachten Bahn, 2021, S. 37 ff. Tz. 72 ff.
- Siehe zuletzt etwa Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Bahn, 2025, S. 17 ff. Tz. 32 ff.
- Zum Nachfolgenden insgesamt Bundesministerium für Verkehr, a. a. O., S. 21 f.
- Siehe etwa Monopolkommission, 8. Sektorgutachten Bahn, 2021, S. 41 f. Tz. 81 ff.
- Hierzu und zum Folgenden Bundesministerium für Verkehr, a. a. O., S. 30.
- Monopolkommission, 10. Sektorgutachten Bahn, 2025, S. 35 Tz. 77.
- Siehe im Einzelnen Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Sachstand „Zur Frage der Berücksichtigung einer Eigenkapitalerhöhung der Deutschen Bahn AG durch den Bund im Rahmen der Schuldenbremse“ v. 29.11.2023 – Az. WD 4 – 3000 – 080/23.
- Wachinger/Scholz/Diekmann, N&R 2025, 270.
- Bundesnetzagentur, Beschl. v. 4.10.2024 – Az. BK10-24-0058_E; siehe zum Ganzen Ostendorf, N&R 2025, 126, 127.
- VG Köln, N&R 2025, 122, 125 (Beschl. v. 24.1.2025 – Az. 18 L 2172/24).
- BT-Drs. 21/1499.
- Zum Ganzen Uhlenhut, N&R 2025, 62, 63.
- VG Köln, N&R 2025, 58 (Beschl. v. 6.11.2024 – Az. 18 L 678/24).
- EuGH, N&R 2025, 266, 269 f. = ECLI:EU:C:2025:367, Rn. 82 ff.(Urt. v. 22.5.2025 – Rs. C-538/23) – ÖBB-Infrastruktur und WESTbahn Management.
- Siehe dazu Wachinger/Scholz/Diekmann, N&R 2025, 270, 271 f.
- So Wachinger/Scholz/Diekmann, N&R 2025, 270, 272.
- Vgl. Kommission, Vorschlag für eine Verordnung über die Nutzung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn im einheitlichen europäischen Eisenbahnraum, zur Änderung der Richtlinie 2012/34/EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 913/2010, COM (2023) 443 final.
- Kramer, N&R 2025, 206, 206 f.
- Hierzu und zum Folgenden Bundesministerium für Verkehr, a. a. O., S. 31.