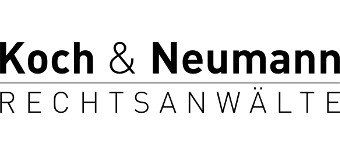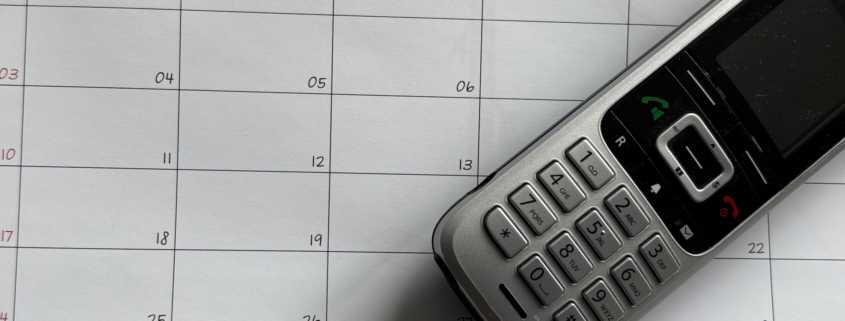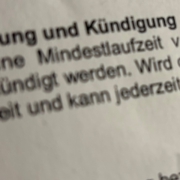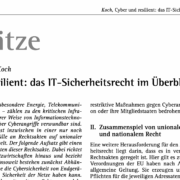BGH: zeitliche Höchstgrenze bei vorzeitiger Verlängerung von Telekommunikationsverträgen
Die zeitlichen Grenzen, die beim Abschluss und der Verlängerung von Verträgen über öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste bestehen, sind in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren gewesen. Sowohl das Telekommunikationsgesetz (TKG) als auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) legen hier für den Bereich des Massengeschäfts eine Höchstgrenze von zwei Jahren fest. Erst unlängst hatte sich das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) in Hamburg dazu geäußert, auf welchen Zeitpunkt für die Bemessung der so begrenzten Vertragslaufzeit abzustellen ist (siehe dazu den Blogbeitrag „OLG Hamburg: Beginn der (anfänglichen) Laufzeit von Telekommunikationsverträgen“ vom 15. Juli 2025). Nunmehr hat sich auch der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil vom 10. Juli 2025 (Az. III ZR 61/24) erstmals ausführlicher zu diesem Themenkomplex zu Wort gemeldet.
I. Telekommunikationsrechtlicher Hintergrund und Sachverhalt
Nach § 56 Abs. 1 S. 1 TKG darf die anfängliche Laufzeit eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste1 24 Monate nicht überschreiten. Unabhängig davon sieht § 309 Nr. 9 lit. a BGB generell vor, dass Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam sind, die in Verträgen (unter anderem) über die regelmäßige Erbringung von Dienstleistungen eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags vorsehen.
Der BGH hatte nun über einen Fall zu entscheiden, in dem das beklagte Telekommunikationsunternehmen Verbrauchern eine Prämie von 20 Euro für die vorzeitige Verlängerung ihres DSL-Vertrags angeboten hat.2 Konkret beanstandete ein Verbraucherverband eine Klausel, mit welcher sich das Unternehmen von seinen Kunden beauftragen ließ, deren „Tarif im Anschluss an [die] aktuelle Laufzeit um weitere 24 Monate zu den bisherigen Konditionen zu verlängern“ (Rn. 3).
II. Entscheidung des BGH
Der BGH prüfte die Klausel nicht an der Laufzeitbegrenzung aus § 309 Nr. 9 lit. a BGB, auf die einige andere Gerichte bisher vorrangig abgestellt hatten.3 Stattdessen griff er auf § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB zurück. Danach ist eine Klausel in AGB im Zweifel unwirksam, wenn sie von einer gesetzlichen Regelung abweicht und dabei mit deren wesentlichen Grundgedanken nicht zu vereinbaren ist. Diese Voraussetzung sah der BGH hier wegen einer Abweichung von den telekommunikationsrechtlichen Laufzeitvorgaben aus § 56 Abs. 1 S. 1 TKG beziehungsweise aus der Vorgängervorschrift in § 43b S. 1 TKG 2012 als erfüllt an (Rn. 9). Diese Abweichung führe auch zu einer unangemessenen Benachteiligung der Kund:innen im Sinne von § 307 Abs. 1 S. 1 TKG, da von den Kundenschutzvorschriften des TKG gemäß § 71 Abs. 1 TKG (bzw. § 47b TKG 2007) nicht zum Nachteil der Kund:innen abgewichen werden darf (Rn. 29, 41).
1. Abweichung von § 56 Abs. 1 S. 1 TKG
Indem die Klausel eine bindende Verlängerung der Vertragslaufzeit um weitere 24 Monate im unmittelbaren Anschluss an den Ablauf der Laufzeit des aktuellen Vertrags vorsieht, ergebe sich im Zeitpunkt der Vertragsverlängerung eine Laufzeit in Länge der bisherigen Restlaufzeit zuzüglich der 24 Monate (hierzu und zum Folgenden Rn. 14, 40). Die Klausel führe also zu einer Vertragslaufzeit von mehr als zwei Jahren.
a) Anwendbarkeit auf Vertragsverlängerungen
Dabei sei es unerheblich, dass sich die Klausel nicht auf den erstmaligen Vertragsschluss, sondern auf die Verlängerung eines bestehenden Vertrags bezieht (hierzu und zum Folgenden Rn. 15, 32). Denn die Höchstlaufzeitvorgabe des TKG erfasse auch Vertragsverlängerungen. Für diese Gesetzesauslegung stützt sich der BGH erwartungsgemäß auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 13. Februar 2025 (Rn. 17 f., 33 ff.).4 Allemal überzeugend ist es, wenn der BGH diese Rechtsprechung für relevant erachtet, obwohl sie sich auf Art. 30 Abs. 5 der Universaldienstrichtlinie 2002/22/EG bezieht und nicht auf dessen Nachfolgeregelung in Art. 105 Abs. 1 S. 1 der Kommunikationskodexrichtlinie (EU) 2018/1972 (Rn. 34 ff.).
Der BGH hat damit aber in der Sache davon abgesehen, sich im konkreten Fall von der Rechtsprechung des EuGH inhaltlich abzugrenzen. Das wäre zumindest theoretisch möglich gewesen, da im dortigen Fall der Anbieter die im Rahmen der Verlängerung vereinbarten Leistungsverbesserungen sofort umgesetzt und unter Anrechnung der noch nicht abgelaufenen Restlaufzeit des Erstvertrags eine 24 Monate überschreitende Vertragslaufzeit angegeben hatte.5
b) Bindender Charakter der verlängerten Laufzeit
Aber auch einem weiteren Einwand des beklagten Anbieters ist der BGH nicht gefolgt. Dieser hatte geltend gemacht, es stehe nicht fest, dass die verlängerte Laufzeit bindend sei, weil dem Kunden eventuell ein Kündigungsrecht zustehe (Rn. 19). Der BGH bestätigt insoweit zwar, dass sich die telekommunikationsrechtliche Laufzeitbegrenzung nach Sinn und Zweck nur auf eine bindende Vertragslaufzeit beziehe und deshalb durch ein Recht zur vorherigen ordentlichen Vertragskündigung nicht verletzt werde (Rn. 20). Nach dem kundenfeindlichsten Verständnis, das bei der AGB-Kontrolle zugrunde zu legen ist, war nach dem Verständnis des BGH im vorliegenden Fall von einem Ausschluss etwaiger zuvor vereinbarter Kündigungsrechte für die Dauer der Vertragsverlängerung auszugehen (Rn. 21 ff.).
c) Beginn der verlängerten Laufzeit
Hinsichtlich der sehr umstrittenen Frage, ab welchem Zeitpunkt die Vertragslaufzeit zu bemessen ist, die sich an der rechtlichen Laufzeitbegrenzung messen muss, beschränkt sich der BGH ausdrücklich auf den konkret zu entscheidenden Fall:
Bei Verlängerung eines bestehenden Vertrags würden die Leistungen in dem Zeitpunkt, in dem die Einigung über die Vertragsverlängerung erfolgt, bereits erbracht (hierzu und zum Folgenden Rn. 27). Würde man dennoch für die Bemessung des Laufzeitbeginns nicht auf diesen Zeitpunkt des (Verlängerungs-) Vertragsschlusses, sondern auf den Zeitpunkt des Endes der ursprünglichen Vertragslaufzeit abstellen, würde ein einheitlicher Vorgang der Leistungserbringung in zwei unterschiedliche Laufzeiten aufgespalten. Eine spezifische sachliche Rechtfertigung hierfür sei nicht erkennbar. Vielmehr würde sich bei einer frühzeitigen Vertragsverlängerung so gerade die Gefahr einer Beschränkung der Wechselmöglichkeiten verwirklichen, vor der die telekommunikationsrechtliche Laufzeitbegrenzung die Verbraucher:innen schützen wolle.
Dass der BGH die Rechtsprechung des EuGH in diesem Sinne verstehen würde, war angesichts der bereits erwähnten Besonderheiten des von dem EuGH entschiedenen Falls zwar nicht zwingend, aber naheliegend. Insoweit besteht nun Rechtssicherheit für die Marktbeteiligten.
III. Fazit und Ausblick
Nach dem Urteil des EuGH war die nun vorliegende Entscheidung des BGH zu erwarten gewesen. Die Möglichkeit einer inhaltlichen Abgrenzung von der Rechtsprechung des EuGH, die wegen der Besonderheiten des damaligen Falls zumindest theoretisch bestanden hatte, hat der BGH nicht genutzt. Das mag aus Anbieterperspektive zu bedauern sein, schafft aber jedenfalls für den deutschen Markt Rechtssicherheit. Dennoch bleiben wichtige Punkte noch ungeklärt.
Offen bleibt insbesondere nach wie vor die Frage, ob beim erstmaligen Abschluss eines Telekommunikationsvertrags die Besonderheiten des Telekommunikationssektors dazu führen können, dass die Bemessung der Laufzeit nicht mit Vertragsschluss, sondern erst mit der erstmaligen Erbringung des Telekommunikationsdiensts beginnt. Der BGH hat diese Frage ausdrücklich offengelassen (Rn. 26). Gute Gründe sprechen dafür, dass dies jedenfalls für die telekommunikationsrechtliche Laufzeitvorgabe in § 56 Abs. 1 S. 1 TKG der Fall ist (siehe dazu den Blogbeitrag „OLG Hamburg: Beginn der (anfänglichen) Laufzeit von Telekommunikationsverträgen“ vom 15. Juli 2025, unter II. 2.).
Genauso offen bleibt aber auch, ob diese spezifische Vorgabe in AGB-Fällen – und damit letzten Endes in den praktisch relevanten Konstellationen – überhaupt zum Tragen kommt oder ob sich hier die möglicherweise (aus Anbietersicht) strengere Sichtweise des § 309 Nr. 9 lit. a BGB durchsetzt. Denn der BGH hat es ausdrücklich dahinstehen lassen, ob § 309 Nr. 9 lit. a BGB neben § 56 Abs. 1 S. 1 TKG anwendbar ist, so dass sich die Unwirksamkeit der Klausel auch (alleine) aus einem Verstoß gegen jene Vorschrift des allgemeinen Zivilrechts ergeben könnte (Rn. 42). Diese Frage ist in Rechtsprechung und wissenschaftlichem Schrifttum ausgesprochen umstritten. Richtigerweise dürfte die telekommunikationsrechtliche Laufzeitbegrenzung als Spezialvorschrift der allgemeinen Regelung in § 309 Nr. 9 lit. a BGB vorgehen (siehe dazu auch ausführlich den Blogbeitrag „OLG Hamburg: Beginn der (anfänglichen) Laufzeit von Telekommunikationsverträgen“ vom 15. Juli 2025, unter II. 3.).
Es ist zu erwarten, dass – in dem Revisionsverfahren gegen das Urteil des OLG Hamburg – zumindest die erste der beiden Fragen in absehbarer Zeit durch den BGH geklärt wird. Sollte der Gerichtshof dabei die strenge beziehungsweise (je nach Perspektive) verbraucherfreundliche Auffassung bestätigen, dass auch bei § 56 Abs. 1 S. 1 TKG die Laufzeitbemessung mit dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses beginnt, kann er die zweite Frage dahinstehen lassen.
Zugleich hat der BGH in seiner aktuellen Entscheidung für diesen Fall bereits einen möglichen Ausweg für die Vertragspraxis anklingen lassen. Der BGH hat nämlich festgestellt, dass durch eine ausdrückliche Bezugnahme auf die Möglichkeit einer vorfristigen Lösung von dem verlängerten Vertrag die verlängerte Laufzeit ihren bindenden Charakter verliert (Rn. 24). Damit würde zugleich der Konflikt mit der telekommunikationsrechtlichen Laufzeitvorgabe beseitigt. Entsprechende Lösungen sind auch beim Abschluss eines Erstvertrags denkbar.
Natürlich ist nicht zu verkennen, dass eine solche „Laufzeitverlängerung/-vereinbarung light“ dem Amortisationsinteresse der Anbieter nur sehr eingeschränkt Rechnung trägt. Mag sie im Falle der Verlängerung kleinere Prämien wie Bonuszahlungen im zweistelligen Euro-Bereich betriebswirtschaftlich noch rechtfertigen, dürfte für größere Vergünstigungen bei einer solchen Lösung nur bedingt Raum sein. Dennoch könnte eine solche Vorgehensweise für Anbieter in der Hoffnung auf eine verbreitete Wechselträgheit der Kund:innen letztlich durchaus attraktiv sein.
Fußnoten
- Eine Ausnahme gilt für nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste und Übertragungsdienste für die Bereitstellung von Diensten der Maschine-Maschine-Kommunikation.
- BGH, Urt. v. 10.7.2025 – Az. III ZR 61/24.
- Siehe insbesondere KG, Urt. v. 22.5.2024 – Az. 23 UKl 1/24, Rn. 37 ff. (juris); OLG Hamburg, Urt. v. 19.12.2024 – Az. 10 UKl 1/24, Rn. 25 ff.
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82 (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.
- EuGH, ECLI:EU:C:2025:82, Rn. 15 (Urt. v. 13.2.2025 – Rs. C-612/23) – Verbraucherzentrale Berlin.