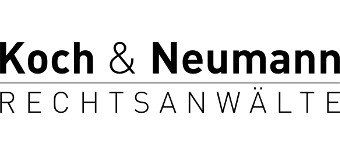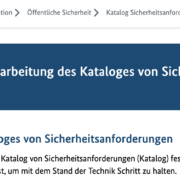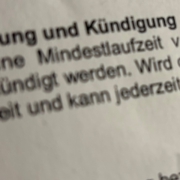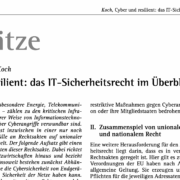Öffentliche Zugänglichkeit von Telekommunikationsdiensten – Impulse aus dem EU-Flugreiserecht?
Einer der zentralen Regelungsgegenstände des Telekommunikationsgesetzes (TKG) sind Telekommunikationsdienste. Dabei gelten die einschlägigen Vorschriften des Gesetzes allerdings ganz überwiegend nicht für alle Telekommunikationsdienste, sondern nur für solche, die „öffentlich zugänglich“ sind. Wann ein Dienst „öffentlich zugänglich“ ist, beantwortet das TKG zwar in § 3 Nr. 44 dahingehend, dass er hierfür „einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung stehe[n]“ muss. Damit ist das Problem aber nur auf die Frage verlagert, wann ein solcher unbestimmter Personenkreis vorliegt. Diese Frage ist trotz ihrer Bedeutung bislang nicht abschließend beantwortet. Impulse für eine Klärung könnten nun angesichts einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus einem anderen Rechtsgebiet kommen, dem EU-Flugreiserecht.
I. Telekommunikationsrechtlicher Hintergrund
Die öffentliche Zugänglichkeit eines Telekommunikationsdiensts ist Tatbestandsvoraussetzung zahlreicher zentraler Vorschriften des TKG. Das betrifft insbesondere auch die Regelungen des Telekommunikationskundenschutzes. Sie verpflichten zum einen in der Regel nur Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste (siehe etwa § 51 Abs. 1 S. 1, § 54 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 1 S. 1 TKG und so weiter). Und zum anderen schützen sie Endnutzer und unter diesen vor allem Verbraucher. Endnutzer und Verbraucher sind aber gerade auch dadurch charakterisiert, dass sie einen öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienst in Anspruch nehmen (möchten) (§ 3 Nr. 13 in Verbindung mit Nr. 41 TKG beziehungsweise Art. 2 Nr. 15 der Kommunikationskodexrichtlinie [EU] 2018/1972). Von der Frage, wann ein Dienst „öffentlich zugänglich“ ist, hängt damit ganz wesentlich die Anwendung wichtiger Teile des TKG ab.
Nach § 3 Nr. 44 TKG sind öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste „einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung stehende Telekommunikationsdienste“. Dieser Legaldefinition ist zwar zu entnehmen, dass sich die öffentliche Zugänglichkeit nach der Verfügbarkeit für einen unbestimmten Personenkreis richtet.[1]BGH, Urt. v. 18.11.2021 – Az. I ZR 106/20, Rn. 57. Wann ein Personenkreis „unbestimmt“ ist, ergibt sich aus ihr jedoch nicht. Auch die Gesetzesmaterialien schweigen dazu: In der Begründung zum Gesetzentwurf heißt es lediglich, die zuvor in § 3 Nr. 17a TKG 2012 enthaltene Definition werde „inhaltlich präzisiert“ und beziehe sich außerdem sowohl auf natürliche als auch auf juristische Personen.[2]Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 19/26108, 200, 234 (zu § 3 Nr. 44). § 3 Nr. 17a TKG 2012 definierte öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste noch lapidar als „der Öffentlichkeit zur Verfügung stehende Telekommunikationsdienste“. Den seinerzeitigen Gesetzesmaterialien[3]Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 17/5707, 43, 50 (zu Nr. 3 lit. o [§ 3 Nr. 17a]). sind insoweit auch keine weiterführenden Abgrenzungskriterien zu entnehmen.
II. Abgrenzung in der Rechtsprechung
Die jüngere Rechtsprechung der Zivilgerichte hat sich für den Fall um eine Abgrenzung bemüht, in dem es um Telekommunikationsdienste ging, die (nur) gegenüber den Mieter:innen einer großen Wohnungsverwaltungsgesellschaft erbracht wurden.
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hatte für diesen Fall noch angenommen, dass die Dienste keinem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung stünden.[4]Hierzu und zum Folgenden OLG Hamm, Urt. v. 28.5.2020 – Az. 4 U 82/19, Rn. 84 (NRWE). Vielmehr handele es sich um eine von der Öffentlichkeit durch ihre Eigenschaft als Mieter:innen von Wohnungen in bestimmten Immobilien klar abgegrenzte Personengruppe. Die Telekommunikationsdienste stünden auch nicht jeder Person, die nach der Eigenart der Leistung als Nutzer:in in Betracht kommt, zur Verfügung, sondern nur einem (kleinen) Teil dieser Personengruppe, nämlich den Mieter:innen der betreffenden Wohnungsverwaltungsgesellschaft. Dass die Wohnungen selbst „öffentlich“ auf dem Wohnungsmarkt angeboten werden, ändere hieran nichts, da die vorliegend entscheidende Bereitstellung der Telekommunikationsdienste an den Abschluss eines Mietvertrags als eine weitere persönliche Voraussetzung geknüpft sei.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dieser Einschätzung allerdings widersprochen.[5]Hierzu und zum Folgenden BGH, Urt. v. 18.11.2021 – Az. I ZR 106/20, Rn. 58. Er hat dabei darauf abgestellt, dass sich das Wohnungsangebot und das damit verbundene Angebot zur Nutzung der Telekommunikationsdienste an jedermann richteten. Jedenfalls angesichts des Umstands, dass über 100 000 Haushalte diese Dienste nutzten, müsse das Angebot als „öffentlich zugänglich“ angesehen werden.
III. Kritische Würdigung
Sonderlich überzeugend ist diese Rechtsprechung des BGH nicht. Richtig ist sicherlich, dass sich das Angebot der Mietwohnungen zunächst an jedermann und damit an einen unbestimmten Personenkreis richtet. Das Angebot der Telekommunikationsdienste als solches richtet sich jedoch nicht an jedermann, sondern nur an diejenigen, die auch einen Mietvertrag abschließen.[6]Kritisch daher auch etwa Enaux/Wüsthof, N&R 2022, 43, 44 f. Würde man allein auf die erste Ebene – den Mietvertrag – abstellen, sind nur wenige Angebotsgestaltungen denkbar, bei denen die öffentliche Zugänglichkeit zu verneinen ist.
So richtet sich auch das Angebot von Hotelzimmern zunächst einmal an einen unbestimmten Personenkreis. Damit würde auch das Angebot eines Internetzugangs für die späteren Hotelgäste zum Angebot öffentlicher Telekommunikationsdienste.[7]Die Bundesnetzagentur geht bei dieser Fallkonstellation davon aus, dass schon kein Telekommunikationsdienst erbracht würde. Stattdessen werde nur die Möglichkeit eingeräumt, einen eigenen … Continue reading Entsprechendes würde – Anforderungen an die Nutzungsberechtigung bzw. Qualifikation genauso ausgeblendet wie Liquiditätsanforderungen bei dem Angebot von Mietwohnungen – für das Angebot von Krankenhauszimmern, Studienplätzen, Arbeitsplätzen und so weiter gelten. Hotel- und Krankenhausbetreiber:innen, Universitäten sowie Arbeitgeber:innen müssten dann auch die kundenschutzrechtlichen Vorschriften und weitere Vorgaben des TKG einhalten, obwohl hier das Angebot von Telekommunikationsdiensten nur eine untergeordnete Nebenleistung zum eigentlichen Leistungsangebot darstellt.
Auch dem BGH sind daher wohl Zweifel daran gekommen, ob seine gesamtheitliche Betrachtung zutreffend ist. Er hat deshalb auf die große Zahl der Nutzer:innen des betreffenden Telekommunikationsdiensts abgestellt. Es ist aber nicht ersichtlich, warum aus rechtlicher Sicht die bloße Quantität in eine qualitative Dimension umschlagen sollte. Denn entscheidend ist eben, ob sich das Angebot an einen unbestimmten Personenkreis richtet, nicht aber, ob es ein großer Personenkreis ist.
Legt man die Legaldefinition zugrunde, kommt es vielmehr allein darauf an, an wen sich das Angebot des Telekommunikationsdiensts richtet. Steht er nur bestimmten Personen zur Verfügung, liegt kein öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienst vor, ansonsten handelt es sich um einen solchen Dienst. Das hat das OLG Hamm zutreffend erkannt. Fraglich ist damit eigentlich nur noch, wonach eine solche Begrenzung auf einen Teil der Öffentlichkeit zu beurteilen ist: Reicht es aus, dass der Dienst nur einem Teil der Öffentlichkeit angeboten wird, der durch persönliche Merkmale bestimmt wird, die von dem Anbieter vorgegeben werden (subjektive Bestimmung)? Hat sich diese Begrenzung auf einen Teil der Öffentlichkeit daraus zu ergeben, dass ein zusätzliches, vorgelagertes Rechtsverhältnis zu dem Anbieter vorliegen muss, damit der Telekommunikationsdienst in Anspruch genommen werden kann (rechtliche Bestimmung)[8]So Neumann, Telekommunikationsrecht kompakt, Bd. 2, 2023, S. 6.? In diesen Fällen würde sich die vom Kunden zu treffende Entscheidung zwischen konkurrierenden Angeboten allein auf einen anderen Leistungsgegenstand (wie eine Mietwohnung, eine Arbeitsstelle oder ein Hotelzimmer) beziehen und würden im Rahmen der so begründeten Leistungsbeziehung dann – nur – diesen Kunden auch Telekommunikationsdienste angeboten werden. Sind aber vielleicht noch weitergehend selbst solche Begrenzungen nur relevant, wenn der Telekommunikationsdienst dann auch ausschließlich der internen Kommunikation zwischen den betreffenden Kunden beziehungsweise Nutzern (im Sinne einer geschlossenen Nutzergruppe) dient?[9]Sörup, in: Heun, Handbuch Telekommunikationsrecht, 2. A., 2007, Teil K Rn. 8 (S. 1224); ähnlich auch Busch/Riewerts, K&R 2017, 769, 773. Oder kommt es letzten Endes auf ganz andere Aspekte an – und, wenn ja, auf welche?
Gegen die erste Sichtweise sprechen jedenfalls gewichtige Argumente. Denn bei einer bloß subjektiven Bestimmung hätte es der Anbieter (vorbehaltlich etwaiger Umgehungsverbote) in der Hand, sich den Vorgaben für das Angebot öffentlicher Telekommunikationsdienste zu entziehen, indem er sein Dienstegesamtangebot einfach in sich ergänzende Teilangebote („Young“-Tarif, „Family“-Tarif, „60+-Tarif“ usw.) fragmentiert.[10]Neumann, a. a. O., S. 6 Fn. 11. Das würde dem Schutzzweck der Vorschriften über die Verpflichtungen beim Angebot öffentlicher Telekommunikationsdienste nicht gerecht.
Aber auch eine besonders weitgehende Sichtweise, der zufolge nur solche Dienste nicht öffentlich zugänglich wären, bei denen der Kommunikationsvorgang selbst auf die interne Kommunikation innerhalb einer geschlossenen Nutzergruppe beschränkt ist, erscheint zweifelhaft. Denn der Legaldefinition zufolge geht es allein um die Frage, ob der Dienst einem unbestimmten Personenkreis zugänglich ist[11]In der englischen Sprachfassung des Kommunikationskodexrichtlinie (EU) 2018/1972 ist von einem „publicly available … service“ die Rede, was noch stärker auf die Relevanz der … Continue reading – nicht aber darum, ob im Rahmen des Dienstes Kommunikationsvorgänge mit einem unbestimmten Personenkreis ermöglicht werden. Insoweit dürfte die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit eher den Aspekt adressieren, ob die Dienste als solche „öffentlich“ am Markt angeboten werden, ob sie also selbst Gegenstand eines Marktgeschehens, eines Wettbewerbs gerade um das Angebot dieser Telekommunikatonsdienste sind, weswegen es gerechtfertigt ist, sie spezifischen rechtlichen Verpflichtungen zu unterwerfen.
IV. Entscheidung des EuGH in der Sache „Qatar Airways“
Zur Klärung, wie der notwendige Öffentlichkeitsbezug genauer zu konkretisieren ist, kann nun möglicherweise eine aktuelle Entscheidung beitragen: In seinem Urteil vom 16. Januar 2025 hat sich der EuGH mit der Frage befasst, wann Schadensersatzansprüche nach der Fluggastverordnung (EG) Nr. 261/2004 bestehen.[12]EuGH, ECLI:EU:C:2025:21 (Urt. v. 16.1.2025 – Rs. C-516/23) – Qatar Airways. Nachfolgend im Text zitierte Randnummern beziehen sich auf diese Entscheidung. Dies richtete sich in dem zu entscheidenden Fall danach, ob der betreffende Tarif „für die Öffentlichkeit … verfügbar“ war (Art. 3 Abs. 3 S. 1 der Fluggastverordnung [EG] Nr. 261/2004). Konkret ging es um eine zeitlich begrenzte Aktion, die ausschließlich Angehörigen der Gesundheitsberufe vorbehalten war.
Dem EuGH zufolge umfasst der Begriff „Öffentlichkeit“ „eine unbestimmte Zahl möglicher Adressaten und setzt im Übrigen recht viele Personen voraus“ (hierzu und zum Folgenden Rn. 35). Im ersten Teil dieser Definition spiegelt sich die auch in § 3 Nr. 44 TKG betonte Notwendigkeit wider, dass der Dienst einem unbestimmten Personenkreis zur Verfügung stehen muss, während der zweite Teil der Definition an die quantitative Argumentation des BGH erinnert. Diese allgemein gehaltene Definition des EuGH ist von besonderem Interesse, weil die Fluggastverordnung (EG) Nr. 261/2004 selbst keine weitere Aussage dazu trifft, wann ein Tarif für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Sie entspricht damit den unionsrechtlichen Grundlagen der deutschen Regelungen über öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste: Auch die Richtlinie (EU) 2018/1972 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (sog. Kommunikationskodex) verwendet den Begriff der öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienste nur, ohne ihn näher zu definieren.
Der EuGH geht dann aber in seinem flugreiserechtlichen Urteil auch noch weiter darauf ein, wie zu prüfen ist, ob eine Gruppe von Personen, zu deren Gunsten ein bestimmter Tarif gilt, von der „Öffentlichkeit“ unterschieden werden kann. Das richte sich danach, „ob diese Gruppe hinreichend genau bestimmt ist, ob die betreffenden Personen die vom Luftfahrtunternehmen [also dem Anbieter] für die Inanspruchnahme dieses Tarifs vorgegebenen besonderen Merkmale erfüllen und ob das Luftfahrtunternehmen eine einzelfallbezogene Zustimmung vor Ausstellung des Beförderungsscheins vorsieht“ (Rn. 35). Im ersten Zugriff klingt das so, als komme es auf eine subjektive Bestimmung (und deren Überprüfung) durch den Anbieter an. Dann wäre ein an die Angehörigen der Gesundheitsbranche gerichtetes Angebot genauso wenig für die Öffentlichkeit verfügbar wie etwa ein Angebot für Studierende.
So ist der EuGH aber nicht zu verstehen. Denn er grenzt im Folgenden eine zur Abgrenzung von der Öffentlichkeit geeignete Bestimmung von einer hierfür nicht geeigneten Angebotsbegrenzung ab: Ein Tarif, der im Rahmen eines Veranstaltungssponsorings nur einigen bestimmten Personen zur Verfügung steht und erst nach einer vorherigen und einzelfallbezogenen Zustimmung des Anbieters eingeräumt wird, ist danach nicht für die Öffentlichkeit verfügbar. (Rn. 37). Das Angebot eines Tarifs für die Gruppe der Angehörigen der Gesundheitsberufe, „die abstrakt, ohne nähere Angabe zu den sie verbindenden besonderen Merkmalen beschrieben werden und zu deren Gunsten die [Erbringung des Angebots] keiner einzelfallbezogenen Zustimmung im Vorfeld unterliegt“, kann demgegenüber öffentlich zugänglich sein (Rn. 36). Entscheidend ist für den EuGH insoweit, dass letztgenanntes Angebot zwar nicht für die gesamte Bevölkerung verfügbar war, aber für eine Gruppe, die sich aus einer unbestimmten Zahl von Personen zusammensetzt und bei der keine besondere Verbindung zu dem Anbieter über den Rahmen einer Kundenbeziehung hinaus besteht – und nicht etwa nur für einige individuell bestimmte Personen (Rn. 38). Die Abgrenzung zu den Fällen, in denen eine besondere Verbindung über den Rahmen einer Kundenbeziehung hinaus besteht, entspricht im Kern der Annahme einer rechtlichen Bestimmung des von der Öffentlichkeit zu unterscheidenden Adressatenkreises. Der EuGH weist in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass eine enger gefasste Auslegung des Begriffs der „Öffentlichkeit“, die auch eine weit gefasste Personengruppe wie die Angehörigen der Gesundheitsberufe ausschließt, dem flugreiserechtlichen Ziel eines hohen Schutzniveaus für Fluggäste zuwiderliefe (Rn. 40).
Fasst man die Aussagen des EuGH zusammen, ergibt sich folgendes Bild:
- Ein Angebot ist öffentlich, wenn es sich an eine unbestimmte Zahl möglicher Adressaten und insoweit an recht viele Personen richtet.
- Ein Angebot richtet sich jedenfalls dann an eine unbestimmte Zahl möglicher Adressaten, wenn es für die gesamte Bevölkerung verfügbar ist.
- Ein Angebot richtet sich aber auch dann an eine unbestimmte Zahl möglicher Adressaten, wenn es sich an eine abstrakt, ohne nähere Angabe zu den sie verbindenden besonderen Merkmalen beschriebene Bevölkerungsgruppe richtet, zu deren Gunsten die Erbringung des Angebots keiner einzelfallbezogenen Zustimmung im Vorfeld unterliegt. Das ist der Fall, wenn sich die Gruppe aus einer unbestimmten Zahl von Personen zusammensetzt, bei denen keine besondere Verbindung zu dem Anbieter über den Rahmen einer Kundenbeziehung hinaus besteht.
V. Konsequenzen für die Auslegung des Begriffs der öffentlichen Zugänglichkeit von Telekommunikationsdiensten
Es spricht sehr viel dafür, diese Erkenntnisse auf das Telekommunikationsrecht zu übertragen. Juristische Begriffe sind zwar stets in ihrem konkreten normativen Kontext auszulegen. Das schließt es aus, allein aus der Verwendung derselben oder ähnlicher Begriffe quasi automatisch auf denselben Bedeutungsgehalt zu schließen. Vorliegend bestehen jedoch deutliche Parallelen, die eine zumindest tendenzielle Übertragbarkeit durchaus nahelegen dürften. In beiden Fällen geht es darum, dass öffentliche von nicht öffentlichen Angeboten abgegrenzt werden sollen und Anbieter öffentlicher Angebote strengeren Vorgaben insbesondere auch im Bereich des Kundenschutzes unterworfen werden sollen als Anbieter nicht öffentlicher Angebote.
Ob ein Telekommunikationsdienst öffentlich zugänglich ist, ließe sich dann anhand der oben wiedergegebenen Kriterien des EuGH prüfen. Auch hierbei verbleiben zwar einige Auslegungsspielräume. Das zentrale Abgrenzungsmerkmal zwischen dem Bereich, der besonderen telekommunikationsrechtlichen Verpflichtungen unterliegt, und dem insoweit unregulierten Bereich, in dem gegebenenfalls ein Rückgriff auf allgemeine (insbesondere zivilrechtliche) Vorgaben notwendig und möglich bleibt, würde hierdurch jedoch deutlich operabler als bislang.
Das betrifft gerade auch die oben (unter III.) aufgeführten Beispiele: Will man hier nicht schon das Erbringen eines Telekommunikationsdiensts verneinen, wären doch durchgängig die besonderen Merkmale, anhand derer die Mitglieder der jeweils angesprochene Bevölkerungsgruppe untereinander verbunden sind, näher bestimmt. Diese Verbindung wäre nämlich durch die jeweils erforderliche besondere Beziehung zu dem Anbieter näher gekennzeichnet, also etwa durch die Notwendigkeit eines Mietvertrags mit der betreffenden Wohnungsverwaltungsgesellschaft, durch das Erfordernis einer Einschreibung an der betreffenden Universität oder durch das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zu dem betreffenden Unternehmen. Damit besteht jeweils auch eine besondere Verbindung zu dem Anbieter, die über den Rahmen einer (telekommunikationsrechtlichen) Kundenbeziehung hinausgeht. Die betreffenden Anbieter wären damit nicht als Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste zu qualifizieren. Das würde abweichend von der bisherigen Rechtsprechung des BGH insbesondere auch Wohnungsverwaltungsgesellschaften im Verhältnis zu ihren Mieter:innen einschließen.
Öffentlich zugänglich wären demgegenüber solche Angebote, die sich an lediglich abstrakt beschriebene Bevölkerungsgruppen richten, deren Mitglieder nicht über besondere Merkmale untereinander verbunden sind und insbesondere auch keine spezifische Verbindung zu dem Anbieter aufweisen. Das schließt etwa spezifische Angebote für Jugendliche, Familien und Senior:innen ein.
Fußnoten