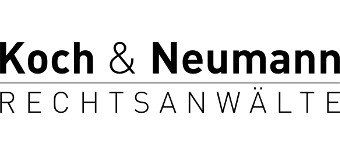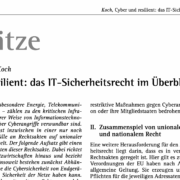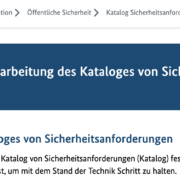Auf dem Weg zu einem Gesamtkonzept für die Kupfer-Glas-Migration: die Eckpunkte des Bundesdigitalministeriums
Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat am 1. Oktober 2025 ein Konsultationspapier über „Eckpunkte für ein Gesamtkonzept zur Kupfer-Glas-Migration“1 (mit Stand von September 2025) vorgelegt. Die Diskussion über das neben dem strategischen Doppelausbau aktuell wohl bedeutsamste telekommunikationspolitische Thema wird hierdurch wesentlich weiterentwickelt. Doch worum geht es und was plant das Ministerium?
I. Die Kupfer-Glas-Migration
Das flächendeckende Festnetz in Deutschland basierte bislang im Wesentlichen auf Kupferkabelanschlüssen. Die einzelnen Haushalte waren also an das Telekommunikationsnetz über eine Kupferdrahtleitung angeschlossen (und sind es nach wie vor in weiten Teilen). Das hat historische Gründe. Die Deutsche Bundespost – und später die Deutsche Telekom AG (DTAG) – hat für ihr bundesweites Netz Kupferkabel verwendet. Diese in der Praxis erprobte und bewährte Technologie war mit Blick auf die damals allein möglichen Sprach- und später Telefaxverbindungen, aber auch für die in den 1980er-Jahren beginnende schmalbandige Datennutzung des „Telefonnetzes“ ausreichend. Mit wachsendem Bandbreitenbedarf wurden die technischen Begrenzungen der Kupferkabeltechnologie dann aber spätestens ab der Jahrtausendwende zunehmend erkennbar. Anders als Kupferkabel erlauben Glasfaserkabel eine weitgehend verlustfreie Datenübertragung bei deutlich geringerem Energieeinsatz und niedrigerer Signalverzögerung (Latenz).
Die DTAG hat daher zunehmend Glasfaserkabelelemente in ihr Netz integriert. In Deutschland verfügen allerdings rund 38 Millionen Haushalte über einen Anschluss an das Festnetz. Ein Austausch all dieser Anschlussleitungen, die ursprünglich ganz überwiegend als Kupferkabelanbindungen ausgeführt waren, war und ist nur mit einem erheblichen Kosten- und Zeitaufwand möglich. Die DTAG beziehungsweise die Telekom Deutschland GmbH (TDG), die seit 2010 das Festnetzgeschäft der DTAG führt, hat deshalb einen sukzessiven Ausbauansatz gewählt. Dabei hat sie die Glasfaserkomponenten ihres Anschlussnetzes zunächst von den rund 8000 Hauptverteilern bundesweit bis zu den rund 330 000 Kabelverzweigern ausgebaut.
Bereits dieser Ausbau hat es ermöglicht, die Datenübertragungsraten mit der Einführung von VDSL flächendeckend zu verbessern, nämlich von den zuvor mit ADSL möglichen 16 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) in Empfangsrichtung („Download“) auf bis zu 50 Mbit/s. Durch die Einführung der „Vectoring“-Technologie konnten sogar noch höhere Datenraten über die Kupferanschlussleitungen zwischen den Kabelverzweigern und den Haushalten bereitgestellt werden, zuletzt bis zu 250 Mbit/s („Supervectoring“).
Doch mittlerweile sind die Bandbreitenanforderungen weiter gestiegen, etwa durch hochauflösendere Videostreamingangebote, zunehmend komplexere Online-Spiele, Cloud-Anwendungen und die parallele Nutzung von Breitbandanschlüssen eines Haushalts durch mehrere Geräte. Diesen Anforderungen kann auch die „vectorisierte“ Kupferanschlussleitung jedenfalls perspektivisch nicht mehr entsprechen. Schon seit vielen Jahren ist deshalb klar, dass die Glasfaser die Telekommunikationsnetzinfrastruktur der Zukunft ist.
Zahlreiche kleinere, aber auch größere Unternehmen haben deshalb schon früh auf diese Anschlusstechnologie gesetzt und in regionalem Maßstab die dortigen Haushalte mit Glasfaserkabeln erschlossen. Man spricht insoweit von „Fiber To The Building“ (FTTB), wenn die Glasfaser bis zum Gebäude geführt wird , und von „Fiber To The Home“ (FTTH), wenn die Glasfaser darüber hinaus auch innerhalb des Gebäudes weiter bis zu den einzelnen Wohnungen geführt wird. Auch die TDG setzt mittlerweile auf einen solchen vollständigen Glasfaserausbau.
Diese Ausbaudynamik hat dazu geführt, dass Ende 2024 bereits rund 5,3 Millionen Haushalte einen FFTH/B-Anschluss nutzten.2 Hinzu kommen etwa 8,5 Millionen Haushalte, die über das ebenfalls gigabitfähige Breitbandkabelnetz, das frühere Fernsehkabelnetz, angeschlossen sind.
Dennoch nutzen nach wie vor über 23 Millionen Haushalte bundesweit für ihren festen Breitbandanschluss eine Kupferanschlussleitung mit DSL. Die Frage, wie und wann auch diese Haushalte mit Glasfaser angebunden und diese Anbindung dann auch tatsächlich nutzen werden, ist komplex und wird seit einiger Zeit von der Branche, der Wissenschaft und der Politik intensiv diskutiert. Man spricht insoweit von der Kupfer-Glas-Migration (KGM). Einigkeit besteht darüber, dass es jedenfalls langfristig keinen Parallelbetrieb von Kupferkabel- und Glasfaserinfrastruktur geben wird. Denn der Weiterbetrieb des weniger leistungsstarken Kupferkabelnetzes ergibt betriebswirtschaftlich bei stetig zurückgehender Nutzung ab einem bestimmten Punkt keinen Sinn mehr. Einigkeit besteht auch dahingehend, dass die Kupfer-Glas-Migration sukzessive in einzelnen Anschlussbereichen erfolgen wird. Es handelt sich also nicht um eine punktuelle bundesweite Umstellung der Anschlusstechnologie.
Bis die Kupfer-Glas-Migration vollständig abgeschlossen ist, ergeben sich aber einige praktische und regulatorische Probleme.
II. Probleme der Kupfer-Glas-Migration für die Nutzer des Kupferkabelnetzes
Diese betreffen zunächst die Endkund:innen: Wird das Kupferkabelnetz in einem Anschlussbereich abgeschaltet, verlieren diejenigen, die dieses Netz noch nutzen, ihren Festnetzanschluss. Hier muss also Sorge dafür getragen werden, dass eine solche Abschaltung erst erfolgt, wenn die betreffenden Endkund:innen zumindest die Gelegenheit hatten, einen Glasfaseranschluss zu erhalten.
Mit der Errichtung eines solchen Anschlusses sind aber auch Bau- und Verlegearbeiten bis zum Haus und unter Umständen auch im Haus selbst verbunden und es entstehen diesbezügliche Kosten, eventuell auch für die Anschaffung eines neuen Endgeräts (Router). Hier stellt sich die Frage, wer diese Kosten tragen soll. Hinzu kommt der Umstand, dass ein Glasfaseranschluss wegen seiner höheren Leistungsfähigkeit (aber auch wegen der Kosten seiner Errichtung) oftmals – wenngleich nicht immer – teurer ist als ein DSL-Anschluss. Die Endkund:innen müssen daher fürchten, nicht nur mit einmaligen Kosten für den Glasfaseranschluss belastet zu werden. Ihnen drohen auch höhere laufende Kosten (für die sie aber natürlich auch ein höherwertiges Produkt erhalten).
Risiken sind mit der Kupfer-Glas-Migration aber auch für solche Telekommunikationsunternehmen verbunden, die bisher DSL-Anschlüsse über das Netz der TDG anbieten. Da nur die TDG über ein (weitgehend) flächendeckendes Kupferkabelnetz verfügt, ist sie seit der Liberalisierung des Telekommunikationssektors Ende des 20. Jahrhunderts verpflichtet, anderen Unternehmen ihr Netz gegen ein entsprechendes Entgelt für das Angebot eigener Telekommunikationsdienste zur Verfügung zu stellen.
Etwa 10 Millionen der rund 23 Millionen Haushalte, die noch das Kupferkabelnetz der TDG nutzen, werden auf diese Weise von Wettbewerbern der TDG versorgt. Die drei größten dieser zugangsbasierten DSL-Wettbewerber sind United Internet (1&1), Vodafone und Telefónica mit zusammen rund 8,6 Millionen Kund:innen.3 Daneben gibt es aber noch viele weitere Anbieter, die insgesamt rund 1,8 Millionen Haushalte versorgen. Solchen Anbietern wäre es bei einer Deaktivierung des Kupferkabelnetzes nach erfolgtem Glasfaserausbau nicht mehr möglich, ihre Kund:innen zu versorgen.
III. § 34 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) als normative Lösung
Der Gesetzgeber hat diese Probleme gesehen und versucht, sie in § 34 des TKG zu lösen. Diese Vorschrift sieht besondere Anforderungen an die „Migration von herkömmlichen Infrastrukturen“ vor. Sie regelt den Fall, dass ein marktmächtiges Unternehmen – also namentlich die TDG – beabsichtigt, (örtlich beschränkte) Teile seines Telekommunikationsnetzes außer Betrieb zu nehmen oder sie durch neue Infrastrukturen – wie insbesondere ein Glasfasernetz – zu ersetzen, und nach Umsetzung dieses Vorhabens bestehenden Zugangsverpflichtungen nicht mehr nachkommen könnte. Eine solche Absicht muss der Bundesnetzagentur rechtzeitig, mindestens aber mit einem Vorlauf von einem Jahr angezeigt werden (§ 34 Abs. 1 TKG). Damit ist sichergestellt, dass es nicht zu einer kurzfristigen Abschaltung des Kupfernetzes kommen kann und die bisher noch nicht migrierten Endkund:innen und Zugangsnachfrager plötzlich keine Netzanbindung mehr haben.
Das marktmächtige Unternehmen muss außerdem (1.) einen Zeitplan für den Migrationsprozess, (2.) die Migrationsbedingungen und (3.) gegebenenfalls einen Antrag auf Änderung eines etwaigen Standardangebots für die ihm von der Bundesnetzagentur auferlegten Zugangsleistungen vorlegen (§ 34 Abs. 2 TKG). Zu den Migrationsbedingungen muss auch eine Beschreibung der alternativen Zugangsangebote gehören, die das marktmächtige Unternehmen während und nach der Migration anbieten wird. Hieran zeigt sich, dass den Wettbewerbsunternehmen, die ihre Endkund:innen bisher über das Kupferkabelnetz der TDG versorgt haben, die Möglichkeit gegeben werden muss, diese Versorgung nunmehr auf anderem Wege, namentlich über das neue Glasfasernetz aufrechtzuerhalten.
Nach einer Konsultation der interessierten Parteien (§ 34 Abs. 3 TKG) prüft die Bundesnetzagentur die von dem marktmächtigen Unternehmen vorgelegten Unterlagen und legt einen transparenten Zeitplan sowie transparente und angemessene Bedingungen fest (§ 34 Abs. 4 S. 1 und 2 TKG). Dazu gehört auch – sofern zur Wahrung des Wettbewerbs und der Endnutzerrechte erforderlich – die Verfügbarkeit alternativer Zugangsprodukte zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (§ 34 Abs. 4 S. 3 TKG). Die Bedingungen der alternativen Zugangsprodukte müssen jedenfalls vergleichbar zu den Bedingungen der zuvor verfügbaren Zugangsprodukte sein, insbesondere auch in Bezug auf Qualität, Geschwindigkeit und Endnutzerreichweite (§ 34 Abs. 4 S. 4 TKG).
Mit diesem System soll sichergestellt werden, dass die DSL-Wettbewerber der TDG, die ihre Endkund:innen bisher über deren Kupferkabelnetz versorgt haben, durch die Abschaltung des Kupferkabelnetzes am Ende der Kupfer-Glas-Migration in einem bestimmten räumlichen Gebiet nicht verdrängt werden, sondern ihren Kundenstamm nunmehr auf Grundlage eines Zugangs zum Glasfasernetz der TDG weiter versorgen können.
Während damit mittelbar auch die Endkund:innen dieser Wettbewerber geschützt werden, trifft § 34 TKG keine Regelung zu den Endkund:innen des marktmächtigen Unternehmens selbst. Der Gesetzgeber geht offensichtlich davon aus, dass das marktmächtige Unternehmen die von ihm bisher über das Kupferkabelnetz versorgten Endkund:innen (etwa durch entsprechend attraktive Angebote oder die Bereitstellung der benötigten Endgeräte) dazu bringt, künftig das Glasfasernetz zu nutzen, und noch verbleibenden Umstellungsverweigerern nötigenfalls kündigt.
Doch auch hinsichtlich der Fragen, die § 34 TKG ausdrücklich anspricht, bleiben viele Details noch offen. Das gilt etwa für den Preis, den die alternativen Zugangsprodukte haben müssen. Denn gerade DSL-Kund:innen sind oftmals sehr preissensitiv, bevorzugen also besonders günstige Produkte. Allerdings erhalten sie mit einem Glasfaseranschluss eben auch ein potentiell (deutlich) höherwertiges Produkt im Vergleich zu ihrem bisherigen DSL-Anschluss. Wie dieses Spannungsfeld aufzulösen ist, lässt sich § 34 TKG nicht ausdrücklich entnehmen.
IV. Probleme der Kupfer-Glas-Migration für die Glasfaserwettbewerber
Ganz andere Herausforderungen birgt die Kupfer-Glas-Migration schließlich für andere Netzbetreiber, die selbst auf lokaler Ebene Glasfaseranschlussnetze errichten. Diese befinden sich nämlich in einem strukturellen Wettbewerbsnachteil gegenüber der TDG, die aus deren Marktmacht im Kupferkabelnetz herrührt. Baut die TDG selbst einen Anschlussbereich mit Glasfaser aus, wird sie, wie soeben dargestellt, ihre eigenen DSL-Endkund:innen jedenfalls in weiten Teilen auf dieses Netz migrieren können. Sie hat auch einen starken Anreiz dazu, um die Kosten für den parallelen Betrieb einer zweiten Anschlussnetzinfrastruktur einzusparen. Außerdem werden die bislang von Wettbewerbern über das Kupferkabelnetz versorgten Endkund:innen nach Abschluss des Migrationsprozesses ebenfalls weitestgehend über das Glasfasernetz der TDG versorgt werden. Die TDG kann daher mit einer starken Auslastung ihres neu errichteten Glasfasernetzes rechnen, was die hierfür nötigen Investitionen erleichert und refinanziert.
Baut jedoch ein anderer Netzbetreiber auf lokaler Ebene ein Glasfasernetz aus, ist er darauf angewiesen, die bisher das Kupferkabelnetz nutzenden Endkund:innen und DSL-Wettbewerber der TDG zu einem Wechsel auf sein Glasfasernetz zu motivieren. Anders als bei einem Glasfaserausbau durch die TDG selbst hat diese aber in einem solchen Fall keinen Anreiz, ihr Kupferkabelnetz außer Betrieb zu nehmen. Vielmehr versorgt die hierüber noch ihre DSL-Kund:innen – sowohl ihre Endkund:innen als auch die Wettbewerber, die über das Netz der TDG eigene Endkund:innen versorgen.
Bei einer Abschaltung des Kupferkabelnetzes müsste die TDG damit rechnen, dass alle diese Kund:innen auf die Glasfaserinfrastruktur ihres Wettbewerbers wechseln werden. Die TDG hat daher im Gegenteil einen starken Anreiz, ihr Kupferkabelnetz in den Glasfaserausbaugebieten anderer Netzbetreiber so lange wie ökonomisch sinnvoll weiterzubetreiben. Jedenfalls solange ein DSL-Anschluss vielen Endkund:innen noch als ausreichend erscheint, haben diese Betreiber es also deutlich schwerer, ihr Glasfasernetz so auszulasten, wie es der TDG bei einem eigenen Glasfaserausbau möglich ist.
Das TKG trifft bislang keine Aussage dazu, wie dieser ungleichen Ausgangslage regulatorisch zu begegnen wäre.
V. Kernaussagen der Eckpunkte
Vor dem Hintergrund dieser komplexen Gemengelage hatten die Regierungsparteien in ihrem Anfang April 2025 vorgestellten und Anfang Mai 2025 unterzeichneten Koalitionsvertrag angekündigt, „ein Konzept für markt- und verbraucherfreundliche Migration von Kupfer- auf Glasfasernetze“ anzustreben.4 In Vorbereitung dieses Vorhabens hatte die Bundesnetzagentur Ende April 2025 bereits ein Impulspapier zur Kupfer-Glas-Migration vorgelegt.5 Hieran knüpfen die nun vom BMDS ausgearbeiteten Eckpunkte inhaltlich an. Begleitend zu den Eckpunkten hat das Ministerium außerdem eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) veröffentlicht, die über die Kupfer-Glas-Migration im europäischen Ausland berichtet.6
1. Notwendigkeit und Grundsätze eines umfassenden Gesamtkonzepts zur Kupfer-Glas-Migration
Nach einleitenden Vorbemerkungen7 betont das Ministerium zunächst, warum aus seiner Sicht ein Gesamtkonzept zur Kupfer-Glas-Migration notwendig ist.8 Hierzu verweist das BMDS auf den ungleichen Informationsstand, über den die einzelnen Marktteilnehmer in Bezug auf die Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen und den Pfad der Abschaltung des Kupfernetzes verfügen. Das führe zu Unsicherheiten und verringere die Investitionsanreize. Ein Gesamtkonzept für die Kupfer-Glas-Migration könne insoweit für die benötigte Transparenz sorgen.
Auch das Ministerium geht von einem sukzessiven Migrationsprozess aus, in dem sich ein vollständiger Wechsel von der Kupfer- auf die Glasinfrastruktur nur gebietsweise und insgesamt über einen längeren Zeitraum hinweg vollziehen wird. Zu Recht stellen die Eckpunkte heraus, dass die Verfügbarkeit vergleichsweise leistungsfähiger Bestandsinfrastrukturen – VDSL sowie das Breitbandkabelnetz – und eine auch deshalb aktuell noch geringe Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen hierbei eine Rolle spielen. Nach Schätzungen des WIK werde eine Abschaltung des Kupferkabelnetzes frühestens ab 2028 beginnen und erst zwischen 2035 und 2040 beendet sein. Einer der Gründe hierfür liege auch in der vorwiegend an einer Gewinnmaximierung ausgerichteten Anreizstruktur der TDG.
Gesamtwirtschaftlich spreche demgegenüber vieles für einen möglichst frühzeitigen Wechsel auf die Glasfasertechnologie. Für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands komme es entscheidend auf leistungsfähige, flächendeckend verfügbare und intensiv genutzte digitale Infrastrukturen an. Dabei seien auch Nachhaltigkeit, Investitionsanreize und eine Überwindung der digitalen Kluft zwischen Stadt und Land zu berücksichtigen. Diese Vorteile würden sich auf eine Vielzahl einzelner Akteure verteilen. Aus der Perspektive der TDG seien sie aber für ihre betriebswirtschaftliche Entscheidung über die Abschaltung des Kupfernetzes nicht maßgeblich. Hieraus zieht das Ministerium die in ihrer Klarheit gleichermaßen bemerkenswerte wie überzeugende Schlussfolgerung, dass „ein rein anreizorientierter Abschalteprozess des Kupfernetzbetreibers zu einem gesamtwirtschaftlich zu langsamen Abschaltepfad hinsichtlich Beginn, Verlauf und Dauer“ führt.
Da die Erfahrungen aus anderen Ländern gezeigt hätten, dass sich der Umstellungsprozess über einen längeren Zeitraum erstrecken werde, solle ein frühzeitiger Beginn des Prozesses erreicht werden. Auch hierzu diene, so ist das Ministerium wohl zu verstehen, die Erstellung eines übergeordneten Gesamtkonzepts. Damit werde überdies dem Umstand Rechnung tragen, dass viele Akteure in den Prozess eingebunden seien, wie auch die vorstehende Darstellung der betroffenen Interessen (unter II. und IV.) gezeigt hat.
Das BMDS formuliert hierauf aufbauend vier Grundsätze, die aus seiner Sicht für einen gelungenen Migrationsprozess gelten sollten:
- Unterstützung einer aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu befürwortenden frühzeitigen und effizienten Migration durch entsprechende Ausgestaltung der Rahmenbedingungen
- Sicherstellung der Angebotsvielfalt und der ununterbrochenen Versorgung der Verbraucher:innen zu angemessenen Preisen
- Sicherstellung eines effizienten Wettbewerbs auch in der Glasfaserwelt
- Rechtzeitige Information aller Beteiligter und Schaffung von Transparenz durch regulatorische Vorgaben und begleitende Öffentlichkeitsarbeit
2. Die einzelnen Eckpunkte
Diese allgemeinen Grundsätze differenziert das Ministerium anschließend in acht konkreten Eckpunkten weiter aus.
- Eckpunkt 1 („Die entscheidende Phase für die Abschaltung des Kupfernetzes ist die der freiwilligen Migration.“):9 Die freiwillige Migration habe angesichts von mittlerweile über fünf Millionen FTTH/B-Anschlüssen bereits begonnen. Je schneller eine freiwillige Migration stattfindet, umso weniger lohne sich der Weiterbetrieb des Kupfernetzes und desto wahrscheinlicher werde seine Abschaltung aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Daher sei die freiwillige Migration für einen effizienten und schnellen Übergang von Kupfer- auf Glasfasernetze von zentraler Bedeutung. Durch attraktive Produkte und Preise sowie eine intensive Vermarktung könne die freiwillige Migration gefördert werden. Auch das BMDS selbst leiste insoweit mit der im September 2025 angelaufenen Informationskampagne („Das beste Internet“10) hier Unterstützung. Entscheidend sei aber auch die tatsächlich Erfahrung mit dem Umstieg auf einen Glasfaseranschluss. Hier nimmt das BMDS die Branche in die Verantwortung und verweist auf eine Vielzahl von Berichten, denen zufolge Endkund:innen Probleme beim Wechsel auf einen Glasfaseranschluss hatten.
- Eckpunkt 2 („Eine beschleunigte KupferGlas Migration braucht zeitliche Leitplanken.“):11 Im Zusammenhang mit einem auf nationaler und europäischer Ebene diskutierten Zieldatum für eine vollständige Abschaltung des Kupferkabelnetzes erteilt das Ministerium dem von der EU-Kommission diskutierten Jahr 2030 „aus heutiger Sicht“ für Deutschland – zutreffenderweise – eine Absage. Hinsichtlich des Beginns des Abschaltprozesses stellt das BMDS dann eine Drei-Jahres-Regel zur Diskussion: Für jedes abschaltfähige Gebiet (und auch für die Bundesrepublik insgesamt) sollte die Abschaltung innerhalb von drei Jahren erfolgen, sobald dort FTTH-Netze flächendeckend verfügbar und auch die sonstigen Abschaltvoraussetzungen (insbesondere wettbewerbliche Auswahlmöglichkeiten) gegeben sind. Die Verfügbarkeit solle anhand einer vorzugebenden Versorgungsschwelle festgestellt werden. Eine solche Drei-Jahres-Regel würde die Kupfer-Glas-Migration vermutlich spürbar beschleunigen und überdies sicherstellen, dass die Entscheidung für die Abschaltung des Kupfernetzes nicht allein von der TDG anhand betriebswirtschaftlicher und eventuell auch strategischer Erwägungen getroffen wird.
- Eckpunkt 3 („Kupfernetze in Ausbaugebieten der Deutschen Telekom und der Wettbewerber sollen diskriminierungsfrei abgeschaltet werden.“):12 In diesem Eckpunkt adressiert das Ministerium das oben (unter IV.) dargestellte Problem, dass die TDG starke Anreize hat, die Kupfer-Glas-Migration in den Ausbaugebieten zu verzögern, in denen andere Unternehmen das Glasfasernetz ausgebaut haben. Es sei daher darüber nachzudenken, in dem Verfahren nach § 34 TKG auch die Interessen dieser Unternehmen zu berücksichtigen und der Bundesnetzagentur die Möglichkeit zu geben, die TDG bei einer diskriminierenden Abschaltpraxis auch an einer Abschaltung in ihren eigenen Ausbaugebieten zu hindern.13 Noch weitergehend will das Ministerium auch die Schaffung eines regelgebundenen Verfahrens prüfen, das an das Erreichen eines bestimmten Glasfaserausbaugrads und weiterer objektiv feststellbarer Voraussetzungen geknüpft wäre und auch von anderen Unternehmen als der TDG oder der Bundesnetzagentur initiiert werden könnte. Ein solches Drittinitiativrecht sei aber unionsrechtlich problematisch, weshalb sich das Ministerium dafür einsetzen werde, dass die Frage eines diskriminierungsfreien regelgebundenen Abschaltmechanismus für die Kupfer-Glas-Abschaltung Eingang in die laufende Diskussion um die Schaffung eines Rechtsakts über digitale Netze („Digital Networks Act“, DNA) findet.
- Eckpunkt 4 („Glasfaser ausbauende Unternehmen brauchen rechtzeitig Transparenz über den gesamten Abschalte und Migrationsprozess.“):14 Anknüpfend an die bereits (oben, unter 1.) beschriebene Informationsasymmetrie zulasten der Glasfaser ausbauenden Wettbewerber TDG kritisiert das Ministerium bemerkenswert deutlich die bisherige Zurückhaltung der Bundesnetzagentur, die in ihrer Regulierungsverfügung von der Auferlegung spezifischer Informationspflichten abgesehen hatte, als „[a]us heutiger Sicht … nicht länger ausreichend“. Kritisiert wird auch die TDG, die nach wie vor keinen verlässlichen und angemessenen Migrationsplan vorgelegt habe. Das Ministerium prüfe in diesem Zusammenhang auch, im TKG eine erweiterte Transparenzverpflichtung zu schaffen, auf deren Grundlage die Bundesnetzagentur die TDG verpflichten könnte, bei weiterer Untätigkeit einen Migrationsplan und einen Gesamtplan für die Migration zu entwickeln. Der Ansatz erscheint innovativ, durchaus vielversprechend und zugleich als gleichermaßen deutliche wie nachvollziehbare Abkehr von dem bisher betonten Initiativrecht der TDG.
- Eckpunkt 5 („Endkunden dürfen durch die Migration keine Verschlechterung der Kommunikationsmöglichkeiten erfahren.“):15 Endkund:innen sollten davon ausgehen können, dass sie nach Abschaltung des Kupfernetzes auf einer anderen Netzinfrastruktur mindestens die gleiche Qualität ihrer Kommunikationsdienste behalten. Bei Nichtverfügbarkeit eines Glasfaseranschlusses müssten daher hinreichende Alternativprodukte angeboten werden. Elementar sei die Sicherstellung einer möglichst unterbrechungsfreien Versorgung über den gesamten Migrationsprozess. Auch die Angemessenheit der Preise für die angebotenen Produkte müsse sichergestellt sein. Hier verweist das Ministerium darauf, dass bereits heute Preise für Glasfaseranschlüsse mitunter niedriger seien als bei DSL-Anschlüssen. Aus heutiger Sicht bestehe deshalb keine Notwendigkeit für regulatorische Vorgaben für ein Angebot so genannter „Low-Cost“-Produkte (mit niedriger Bandbreite). Entsprechendes gelte mit Blick auf beispielsweise mobilfunkgestützte Alternativen für reine Telefonieangebote. Diese Einschätzung erscheint namentlich mit Blick auf einen Preisvergleich zwischen Glasfaser und DSL ein wenig optimistisch.
- Eckpunkt 6 („Für eine verbraucherfreundliche Migration ist eine transparente Kommunikation mit Endkunden und Kommunen erforderlich.“):16 Die erwünschte Transparenz für die Bürger:innen und Kommunen treffe in der Praxis auf verschiedene Schwierigkeiten. So sei es sehr aufwendig, Anschlussdaten zu erfassen und abzugleichen, Hauseigentümer verweigerten die Zusammenarbeit, datenschutzrechtliche Vorgaben und veraltete Datensätze erschwerten die Kundenansprache und die für eine Abschaltung aus technischer Sicht geeigneten Gebiete stimmten nicht immer mit den Gebietszuschnitten einer Kommune überein. Das Ministerium werde zusammen mit dem Gigabitbüro des Bundes hier verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Information auf den Weg bringen.
- Eckpunkt 7 („BNetzA setzt zentrale Weichen für die Kupfer-Glas-Migration durch Erstellung eines Regulierungskonzepts.“):17 Die Konsultation zum Impulspapier der Bundesnetzagentur aus dem April 2025 habe gezeigt, dass wesentliche Fragen in Bezug auf den Migrationsprozess regulatorisch noch zu entscheiden sind. Um die Migration insgesamt deutlich zu beschleunigen und die Transparenz für alle Marktteilnehmer zu erhöhen, könnten diese Fragen zeitnah bereits im Vorfeld eines konkreten Antrags der TDG geklärt werden, etwa im Rahmen eines Regulierungskonzepts der Bundesnetzagentur.18 In einem solchen Regulierungskonzept könnten etwa Aussagen zum Zuschnitt der Abschaltgebiete, zur Versorgungssschwelle für das Glasfaserzielnetz, zur Versorgung der Endkunden außerhalb der Versorgungsschwelle mit alternativen Technologien und zu alternativen Zugangsprodukte getroffen werden. Dabei diskutiert das Ministerium auch bereits konkrete Ausgestaltungsmöglichkeiten zu den einzelnen Punkten. So sollte die Versorgungsschwelle aus Sicht des BMDS so zu bestimmen sein, dass für die Migration nahezu alle Anschlüsse in einem Abschaltgebiet mit Glasfaser angeschlossen sein müssen. Wie die – als solche sicherlich sehr sinnvolle – Anregung zum Erlass eines entsprechenden Regulierungskonzepts sind auch diese Ausführungen angesichts der Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur nur als fachkundige Diskussionsbeiträge zu werten. Das gilt auch für die weiteren Anregungen, dass Fragen der Kupfer-Glas-Migration auch in den aktuell laufenden Regulierungsverfahren für die Festnetz- und Mietleitungsmärkte und/oder durch eine Anpassung der Standardangebote bereits im Vorfeld eines konkreten Migrationsverfahrens geklärt werden könnten. Besonders bemerkenswert ist der in diesem Zusammenhang geäußerte und sehr konkrete Vorschlag, die Bundesnetzagentur möge bei einer Überprüfung der Ausgestaltung des so genannten „Commitment-Modells“ der TDG, einem Risikoteilungsmodell mit ihren großen Zugangsnachfragern, auch die Anreizwirkungen im Sinne einer effizienten Kupfer-Glas-Migration berücksichtigen. Zugleich fordert das Ministerium aber auch die alternativen Glasfasernetzbetreiber auf, die Attraktivität ihrer Angebote für potentielle Zugangsnachfrager zu erhöhen, namentlich durch einen offenen Netzzugang („Open Access“). Dieser ist aus wettbewerbspolitischer und -rechtlicher Sicht ohnehin von überragender Bedeutung.19
- Eckpunkt 8 („BNetzA wird für ein transparentes Monitoring und effizientes Prozessmanagement sorgen.“):20 Im letzten Eckpunkt verweist das Ministerium auf die Notwendigkeit, auf unerwartete Hindernisse im Migrationsprozess flexibel reagieren zu können, und kündigt an, der Bundesnetzagentur deshalb die Möglichkeit einzuräumen, die Bedingungen für die Kupfernetzabschaltung nach Bedarf anzupassen. Angesichts der damit verbundenen Einbuße an Planungssicherheit sollte ein transparentes Monitoring und effizientes Prozessmanagement unter Einbindung der jeweils Betroffenen in die Entscheidungsprozesse etabliert werden. Hierfür käme vor allem die Bundesnetzagentur in Betracht, die aber hierbei durch die Branche insgesamt unterstützt werden müsse.
3. Weitere Maßnahmen zur Beschleunigung der Kupfer-Glas-Migration
Im Anschluss an die Formulierung der Eckpunkte weist das Ministerium darauf hin, dass eine Vielzahl von Maßnahmen, die den Ausbau von Glasfaseranschlüssen fördern sollen, mittelbar auch zum Gelingen der Kupfer-Glas-Migration beitrage.21 Das ergebe sich bereits daraus, dass die flächendeckende Verfügbarkeit alternativer (insbesondere Glasfaser-) Infrastrukturen tatsächliche Voraussetzung für die Abschaltung des regulierten Kupfernetzes sei.
- Gigabitförderung: Das Ministerium verweist vor diesem Hintergrund zunächst auf die Gigabitförderung, die bereits heute auf eine Flächendeckung und einen Ausbau bis zu den Gebäuden abziele und nach einer Evaluierung fortgeführt werden solle.
- Inhausverkabelung: Als weiteren Punkt spricht das Ministerium das Problem der Inhausverkabelung (auf der so genannten „Netzebene 4“) an. Diese müsse für eine vollständige Abschaltung des Kupfernetzes in Mehrfamilienhäusern auf Glasfaserbasis ausgebaut werden, was aktuell nur sehr langsam und unvollständig erfolge. Im Rahmen der anstehenden TKG-Novelle werde das Ministerium konkrete Gesetzesänderungen vorschlagen, welche die hier bestehenden Hemmnisse abbauen sollen.
- „Homes Connected“: Darüber hinaus sei in den letzten Jahren beim Glasfaserausbau der Anteil der angeschlossenen Gebäude („Homes Connected“) gesunken. Das Ministerium sieht als möglichen Grund hierfür die fehlende Zustimmung des Gebäude- oder Grundstücksbesitzers, aber auch unternehmensstragische Überlegungen. Letzteres entspricht einem verbreiteten Hinweis von Wettbewerberseite, die der TDG vorwerfen, möglichst schnell möglichst viele Straßenzüge mit Glasfaser auszubauen, um den Ausbau durch ein anderes Unternehmen unwirtschaftlich zu machen (Politik des „Handtuchwurfs“). Das BMDS kündigt hier vor allem eine Verbesserung der Informationsgrundlage an, indem die „Homes Connected“ im Breitbandatlas des Bundes adressgenau erfasst werden sollen.
- Gigabitforum: Zu guter Letzt betont das Ministerium die Bedeutung des bei der Bundesnetzagentur eingerichteten Gigabitforums als einer wichtigen Austauschplattform auch zur Kupfer-Glas-Migration. Angesichts der vielfältigen praktischen Fragen und Herausforderungen sei die erfolgreiche Durchführung eines umfassenden, beispielsweise eine gesamte Gemeinde umfassenden Pilotprojekts, eine zentrale Voraussetzung für den nachfolgenden Migrationsprozess.
VI. Fazit
Mit seinem Eckpunktpapier leistet das Bundesdigitalministerium einen wichtigen Beitrag für die weitere Ausgestaltung der Kupfer-Glas-Migration. Das Ministerium hebt dabei den Nutzen einer möglichst frühzeitigen und effizienten Migration völlig zu Recht sehr deutlich hervor. In erfreulicher Klarheit benennt es die volkswirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Risiken, die dagegen ein rein aus betriebswirtschaftlichen Motiven gesteuerter Migrationsprozess mit sich bringen würde. Vor diesem Hintergrund scheint das Ministerium gewillt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen kraftvoll weiterzuentwickeln, greift dabei bereits vorliegende Vorschläge auf und verfolgt zusätzlich auch sehr vielversprechende eigene Ansätze.
Die darüber hinausgehenden Vorschläge an die Bundesnetzagentur – etwa zur vorzeitigen Ausarbeitung eines Regulierungskonzepts zum Migrationsprozess – sind demgegenüber nur genau das: Vorschläge. Ob und inwieweit die Bundesnetzagentur sie aufgreifen wird, bleibt abzuwarten. Im Sinne der Förderung einer beschleunigten Kupfer-Glas-Migration und der Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs auch in der „Glasfaserwelt“ wäre es aber angesichts der zentralen Bedeutung dieses Infrastrukturprojekts sicher wünschenswert, dass auch die Bundesnetzagentur von den ihr zustehenden Befugnissen weiterhin tatkräftig Gebrauch macht.
Aktuell haben aber zunächst einmal alle Interessierten die Möglichkeit, zu den Eckpunkten bis zum 14. November 2025 Stellung zu nehmen.22 Die Ergebnisse dieser Anhörung werden dann in ein künftiges Gesamtkonzept und vor allem in den von der Branche erwarteten Gesetzentwurf für eine TKG-Novelle (auch zur Umsetzung der Gigabit-Infrastrukturverordnung [EU] 2024/1309, dem „Gigabit Infrastructure Act“ bzw. GIA) einfließen.
Fußnoten
- BMDS, Konsultationspapier „Eckpunkte für ein Gesamtkonzept zur Kupfer-Glas-Migration“, 9/2025.
- Alle Zahlen, die im Einzelnen leicht divergieren, nach Bundesnetzagentur, Jahresbericht Telekommunikation 2024, 2025, S. 13; Böcker, BREKO Marktanalyse 2025 v. 14.8.2025, S. 33; Verband der Anbieter im Digital- und Telekommunikationsmarkt (VATM) e. V./Dialog Consult, 26. TK-Marktanalyse Deutschland 2025 v. 29.4.2025, S. 17.
- Hierzu und zum Folgenden Winzer, N&R 2025, 148, 149.
- CDU/CSU/SPD, Verantwortung für Deutschland, Koalitionsvertrag v. 5.5.2025, Tz. 2216 f.
- Bundesnetzagentur, Impulspapier „Impulse zur regulierten Kupfer-Glas-Migration“ v. 28.4.2025.
- Strube Martins/Lachmann/Schwarz-Schilling/Neumann, Bericht „Die Kupfernetzabschaltung in Europa – Was können wir aus dem Ausland lernen?“ v. 5.8.2025.
- BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 4 f.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 6 ff.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 11 ff.
- Zu der Kampagne ist unter https://das-beste-internet.de/ eine eigene WWW-Seite eingerichtet worden.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 13 f.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 14 ff.
- Zu einem entsprechenden Vorschlag bereits Neumann, Gutachten „Gesetzgeberische Spielräume zur Förderung einer wettbewerbskonformen Kupfer-Glasfaser-Migration“ v. 10.4.2024.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 17 f.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 18 f.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 19.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 20 ff.
- Zu den Möglichkeiten und Grenzen eines Regulierungskonzepts für die Kupfer-Glasfaser-Migration siehe Herrmann, N&R 2025, 22.
- Neumann, in: Schwarz-Schilling u. a., Bericht „Doppelausbau von Glasfasernetzen – Ökonomische Analyse und rechtliche Einordnung“, 9/2023, S. 44, 84.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 23.
- Hierzu und zum Folgenden BMDS, Eckpunkte, a. a. O., S. 24 ff.
- Einzelheiten hierzu finden sich auf der diesbezüglichen WWW-Seite des Ministeriums zur „Kupfer-Glas-Migration“.