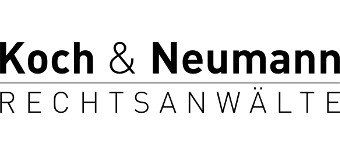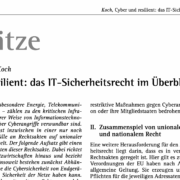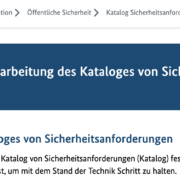BVerwG: Entscheidung über Mitnutzung eines Leerrohrs
Im Jahr 2016 ist das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) in Kraft getreten. Seitdem enthält das Telekommunikationsgesetz (TKG) mehrere Vorschriften, auf deren Grundlage Telekommunikationsunternehmen Bauarbeiten oder vorhandene Infrastruktur von Versorgungsunternehmen mitnutzen können, um schnelle Telekommunikationsnetze auszubauen. Während die Instanzgerichte – allen voran das Verwaltungsgericht (VG) Köln – bereits des Öfteren mit diesen Regelungen befasst waren, ist Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) hierzu bislang rar. Mit Beschluss vom 29. April 2025 (Az. 6 B 14.24) hat das Gericht nun einige umstrittene Fragen zu den Netzausbauvorschriften des TKG geklärt.
I. Telekommunikationsrechtlicher Hintergrund und Sachverhalt
Ein wesentlicher Kostenfaktor beim Ausbau von schnellen Telekommunikationsnetzen – insbesondere Glasfasernetzen – sind die sogenannten Tiefbauarbeiten. Die unterirdische Verlegung von Telekommunikationskabeln verursacht einen hohen Kosten- und Zeitaufwand und geht sowohl mit Beeinträchtigungen für die Umwelt als auch mit Belästigungen für betroffene Anwohner:innen und Verkehrsteilnehmer:innen einher. Das mittlerweile in §§ 136 ff. TKG geregelte Netzausbaurecht[1]Siehe hierzu im ausführlichen Überblick Neumann, Telekommunikationsrecht kompakt, 2022, S. 108 ff. will dem entgegenwirken, indem es die Hebung von Synergien mit Arbeiten und dem Betrieb von öffentlichen Versorgungsnetzen ermöglicht. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Strom- und Gasnetze, aber auch um Verkehrs- und sogar Telekommunikationsnetze.
Neben der Mitnutzung von Bauarbeiten zur Mitverlegung von Telekommunikationsinfrastruktur enthalten die §§ 136 ff. TKG auch ein abgestuftes System von zivilrechtlichen Ansprüchen, die sich auf sog. passive Netzinfrastruktur der Versorgungsunternehmen beziehen. Das sind nach § 3 Nr. 45 TKG „Komponenten eines Netzes, die andere Netzkomponenten aufnehmen sollen, selbst jedoch nicht zu aktiven Netzkomponenten werden“. Gemeint sind damit also insbesondere Kabelkanäle sowie Leer- und Leitungsrohre, in die dann nachträglich (Glasfaser-) Kabel eingezogen werden können, ohne dass dafür ganze Straßenzüge aufgerissen werden müssen. Damit Telekommunikationsunternehmen diese Möglichkeit nutzen können, räumt ihnen das TKG – unter bestimmten Voraussetzungen und in gewissen Grenzen – insbesondere drei Rechtspositionen ein:
- § 136 Abs. 1 und 2 TKG enthalten einen Anspruch auf die Erteilung von Informationen über die passive Netzinfrastruktur. Auf diese Weise können sich Telekommunikationsunternehmen ein Bild von der vorhandenen Infrastruktur machen und bewerten, ob deren Mitnutzung für den geplanten Netzausbau von Nutzen wäre.
- In § 137 Abs. 1 und 2 TKG ist ein Anspruch auf eine Vor-Ort-Untersuchung der passiven Netzinfrastrukturen geregelt. Eine solche Untersuchung kann es den Telekommunikationsunternehmen erlauben, die konkreten Verhältnisse genauer zu bewerten und auf dieser Grundlage eine fundfierte Entscheidung über eine etwaige Mitnutzung zu treffen.
- § 138 Abs. 1 und 2 TKG sehen schließlich sogar einen Anspruch auf Unterbreitung eines Angebots über die Mitnutzung der passiven Netzinfrastrukturen vor. Damit soll der Abschluss entsprechender Vereinbarungen gefördert werden, die zu den oben geschilderten Synergieeffekten führen.
Kommt es zum Streit über solche Ansprüche, etwa weil sich das Versorgungsunternehmen weigert, Auskunft zu erteilen, eine Vor-Ort-Untersuchung zu gewähren oder ein Mitnutzungsangebot abzugeben, sieht das TKG des Weiteren ein behördliches Streitbeilegungsverfahren vor. In solchen Fällen kann nach § 149 Abs. 1 TKG die Bundesnetzagentur angerufen werden, die dann als sogenannte nationale Streitbeilegungsstelle eine verbindliche Entscheidung trifft (§ 149 Abs. 7 TKG).
Im konkreten Fall beantragte ein Telekommunikationsunternehmen bei der späteren Klägerin, einem Eisenbahnunternehmen, die Mitnutzung eines Leerrohrzugangs im Bereich eines Bahnübergangs. Die Klägerin weigerte sich jedoch, ein entsprechendes Angebot abzugeben. Sie bestand vielmehr darauf, dass das Telekommunikationsunterehmen zunächst eine Vor-Ort-Untersuchung beantragen und auf eigene Kosten durchführen müsse, wie es die Nutzungsbedingungen der Klägerin vorsahen. Die daraufhin angerufene Bundesnetzagentur verpflichtete die Klägerin, der Beigeladenen ein Angebot über die Mitnutzung eines Leerrohres mit bestimmten Maßen im Bereich des betreffenden Bahnübergangs zu unterbreiten.[2]Bundesnetzagentur, Beschl. v. 18.9.2023 – Az. BK11-23-008.
Das von der Klägerin im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes angerufene VG Köln erachtete lediglich die flankierende Zwangsgeldandrohung durch die Bundesnetzagentur für rechtswidrig, hielt den Beschluss in der Sache aber für rechtmäßig.[3]VG Köln, Beschl. v. 5.1.2024 – Az. 1 L 2033/23. In der Folge unterbreitete die Klägerin dem Telekommunikationsunternehmen ein Angebot über den Abschluss eines Mitnutzungsvertrags. Sie hat deshalb im Hauptsacheverfahren in erster Linie (nur) noch die Feststellung begehrt, dass der Beschluss der Bundesnetzagentur rechtswidrig gewesen sei. Das VG Köln hat diese Klage abgewiesen, da sich der Beschluss nicht erledigt habe und überdies in der Sache (jenseits der Zwangsmittelandrohung) rechtmäßig sei.[4]VG Köln, Urt. v. 24.5.2024 – Az. 1 K 5359/23. Mit ihrer Beschwerde begehrte die Klägerin die Zulassung der Revision gegen dieses Urteil.
II. Entscheidung des BVerwG
Das BVerwG hat diese Beschwerde zurückgewiesen und die Revision damit nicht zugelassen. Neben hier nicht weiter interessierenden Verfahrensrügen hatte die Klägerin insbesondere rechtsgrundsätzlichen Klärungsbedarf geltend gemacht. Dieser Einschätzung trat das BVerwG entgegen.
1. Erledigung der Angebotsverpflichtung mit Unterbreitung des Angebots?
Da die Klägerin letzten Endes das erwünschte Mitnutzungsangebot abgegeben hatte, war sie der Auffassung, der Beschluss der Bundesnetzagentur habe sich mit der Unterbreitung des Angebots erledigt. Das BVerwG erachtete die in diesem Zusammenhang formulierte Rechtsfrage als nicht klärungsfähig (Rn. 12), was aber Voraussetzung für eine Revisionszulassung wegen grundsätzlicher Bedeutung wäre. Denn die Frage der Erledigung hänge nicht nur vom Regelungsgefüge des anwendbaren Fachrechts, sondern auch von der seitens der Behörde getroffenen Regelung ab und sei damit eine Frage des Einzelfalls (Rn. 13). Hier wird es also auch künftig darauf ankommen, welche konkrete Regelung die Bundesnetzagentur getroffen hat.
2. Regelungsgehalt der Verpflichtung zur Angebotsabgabe
Die Klägerin hielt es daneben aber auch für grundsätzlich klärungsbedürftig, ob sich die Verpflichtung zur Unterbreitung eines Mitnutzungsangebots nach § 149 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 1 TKG (vgl. Rn. 23) auf ein einmaliges Handlungsgebot zur Angebotslegung beschränkt oder einen weitergehenden Regelungsgehalt aufweist (Rn. 14).
Das BVerwG hat sich insoweit auf den Standpunkt gestellt, dass die Antwort auf diese Frage auch ohne Durchführung eines Revisionsverfahren eindeutig sei: Die Verpflichtung zur Unterbreitung eines Angebots nach § 149 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 TKG stelle zugleich fest, dass aufgrund des konkreten Antrags Mitnutzung unter den Bedingungen des § 138 Abs. 2 S. 2 und 3 TKG zu gewähren ist (Rn. 17).
Das ist insoweit eine wichtige Entscheidung, als die sich aus § 138 Abs. 1 und 2 TKG ergebende Verpflichtung ihrem Wortlaut nach ausdrücklich auf die Abgabe eines Angebots beschränkt ist und nicht auch die Mitnutzung selbst umfasst.[5]Stelter, in: Scheurle/Mayen, TKG, 3. A., 2018, § 77d Rn. 8. Das BVerwG kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass die betreffenden Regelungen das Bestehen eines materiellrechtlichen Mitnutzungsrechts voraussetzen (hierzu und zum Folgenden Rn. 18). Es begründet dies damit, dass die Bundesnetzagentur nach der gesetzlichen Konzeption im Streitbeilegungverfahren verbindlich über die betreffenden Rechte, Pflichten oder Versagungsgründe entscheidet. Damit bildeten das Vorliegen der Mitnutzungsvoraussetzungen und das Nichteingreifen eines Versagungsgrunds die zentralen Vorfragen, die von der Bundesnetzagentur vor Erlass einer Streitbeilegungsentscheidung zu prüfen seien. Die Einstufung der Entscheidung als privatrechtsgestaltender Verwaltungsakt durch den Gesetzgeber runde dieses Auslegungsergebnis ab.
Diese Argumentation ist im Ergebnis sachgerecht, in der Begründung aber nicht unbedingt zwingend. Denn wenn der Anspruch aus § 138 Abs. 1 und 2 TKG als solcher wirklich nur auf Abgabe eines Angebots (im Falle fehlender Verweigerungsgründe) gerichtet sein sollte, dann könnten die Rechte, Pflichten und Versagungsgründe, über die von der Bundesnetzagentur nach § 149 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 TKG entschieden wird, eben genauso gut auf die Abgabe eines entsprechenden Angebots beschränkt sein. Das materiellrechtliche Mitnutzungsrecht entstünde dann erst mit der Annahme dieses Angebots.
Man könnte das – zustimmungswürdige – Ergebnis des BVerwG daher mit zwei zusätzlichen Argumenten weiter abstützen: Zum einen sieht § 149 Abs. 2 Nr. 2 TKG vor, dass die Bundesnetzagentur „ein Mitnutzungsentgelt fest[setzen]“ kann. Die Ermächtigung zur Festsetzung des Entgelts deutet darauf hin, dass hier eine zwischen den Parteien wirksame Entgeltregelung getroffen werden kann und es nicht lediglich um die Ausgestaltung des Mitnutzungsangebots geht. Und zum anderen ist der unionsrechtliche Hintergrund zu berücksichtigen. § 138 TKG soll Art. 3 der Kostensenkungsrichtlinie 2014/61/EU umsetzen.[6]Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 18/8332, 28, 44 (zu § 77d). Art. 3 Abs. 2 S. 1 der Richtlinie sieht aber nicht lediglich eine Angebotsverpflichtung vor. Vielmehr ist danach „allen zumutbaren Anträgen auf Zugang … stattzugeben“. Jedenfalls bei unionsrechtskonformer Auslegung impliziert § 138 Abs. 1 und 2 TKG somit ein materiellrechtliches Mitnutzungsrecht. Dementsprechend ist auch der Gesetzgeber des DigiNetzG ohne weiteres davon ausgegangen, mit der Vorschrift würden „Mitnutzungsansprüche“ eingeräumt.[7]Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 18/8332, 28, 44 (zu § 77d).
3. Keine Verpflichtung zur vorherigen Vor-Ort-Untersuchung
Auch hinsichtlich des ursprünglichen Kerns der Auseinandersetzung sah die Klägerin grundsätzlichen Klärungsbedarf gegeben, nämlich bei der Frage, ob ein Versorgungsunternehmen die Unterbreitung eines Mitnutzungsangebots nach § 138 Abs. 2 TKG von der vorherigen Beantragung und Durchführung einer Vor-Ort-Untersuchung im Sinne von § 137 TKG abhängig machen darf (Rn. 19).
Das BVerwG verneinte diese Frage ohne viel Federlesens. § 137 TKG enthalte seinem eindeutigen Wortlaut zufolge einen Anspruch des Telekommunikationsunternehmens auf Durchführung einer Vor-Ort-Untersuchung und eine damit korrespondierende Handlungspflicht des Versorgungsunternehmens (hierzu und zum Folgenden Rn. 20). Eine abstrakte Obliegenheit der Telekommunikationsunternehmen, von diesem Recht auch Gebrauch zu machen, folge daraus nicht. Das überzeugt uneingeschränkt.[8]Vgl. auch Neumann, a. a. O., S. 137; a. A. Leitzke, in: Säcker/Körber, TKG -TTDSG, 4. A., 2023, § 138 Rn. 21 ff. Es ergäbe keinen Sinn und wäre dem Ziel eines beschleunigten Netzausbaus abträglich, müssten Telekommunikationsunternehmen auch dann eine (überdies kostenerzeugende) Vor-Ort-Untersuchung durchführen, obwohl sie diese aufgrund ihres Kenntnisstands für die Entscheidung über eine Mitnutzung überhaupt nicht benötigen.
III. Ausblick
Nach der Entscheidung des BVerwG steht nun vor allem fest, dass es unzulässig ist, die Unterbreitung eines Mitnutzungsangebots von einer vorherigen Vor-Ort-Untersuchung abhängig zu machen. Entsprechende Anforderungen sollten daher in der Praxis nunmehr endgültig aufgegeben werden.
Allerdings verschließt das BVerwG die Tür zu einer verpflichtenden Vor-Ort-Untersuchung auch nicht vollständig – und auch das zu Recht. Es will es nämlich nicht per se ausschließen, dass es zulässig sein kann, „in einem besonders gelagerten Einzelfall auf einer Untersuchung vor Ort als einer fairen und angemessenen Bedingung für die Mitnutzung [zu] bestehen“ (Rn. 20). Das VG Köln hatte noch entschieden, dass das Versorgungsunternehmen eine vorherige Vor-Ort-Untersuchung nicht durch eine diesbezügliche Regelung in den diesbezüglichen Bedingungen (§ 138 Abs. 2 S. 2 TKG) zur Voraussetzung eines Mitnutzungsantrags erheben könne.[9]VG Köln, Urt. v. 24.5.2024 – Az. 1 K 5359/23, Rn. 66 (NRWE). Das BVerwG verortet eine solche Bedingung nun – zu Recht – auf einer Ebene zwischen dem Antrag auf Mitnutzung und ihrer tatsächlichen Gewährung. Der Antrag als solcher kann damit auch im Einzelfall nicht zurückgewiesen werden, weil keine vorherige Vor-Ort-Untersuchung erfolgt ist. Es mag aber in einem besonderen Einzelfall möglich sein, die Mitnutzung nur unter der Bedingung einer vorherigen Vor-Ort-Untersuchung anzubieten.
Welche Gründe hierfür maßgeblich sein können, wird gegebenfalls die weitere Praxis zeigen müssen. Nicht von vornherein ausgeschlossen erschiene es, hier zum Beispiel auf Fälle abzustellen, in denen das betreffende Telekommunikationsunternehmen bereits des Öfteren von der eigentlich begehrten Mitnutzung abgesehen hat, nachdem die Verhältnisse vor Ort entgegen seiner Erwartung einer solchen Mitnutzung entgegenstanden. Aber auch Besonderheiten der betreffenden Infrastrukturen könnten unter Umständen die Bedingung einer vorherigen Vor-Ort-Durchsuchung rechtfertigen. Bei der Entscheidung über diesbezügliche Ausnahmen muss aber in jedem Fall beachtet werden, dass eine solche Pflicht eben grundsätzlich nicht besteht. Nicht angängig wird es daher angesichts der in §§ 136 ff. TKG vorausgesetzten Pflichtenverteilung insbesondere sein, eine vorherige Vor-Ort-Untersuchung zu verlangen, damit sich das Versorgungsunternehmen selbst ein Bild von der betreffenden passiven Infrastruktur machen kann.[10]In diese Richtung aber Leitzke, a. a. O., § 138 Rn. 23 f.
Weiter hat das BVerwG mit dem vorliegenden Beschluss geklärt, dass es einen Anspruch auf Mitnutzung passiver Infrastruktur (und nicht lediglich auf Abgabe eines entsprechenden Angebots) gibt. Das spricht dafür, dass es der Bundesnetzagentur auch möglich sein dürfte, ein Versorgungsunternehmen nicht lediglich zur Abgabe eines Mitnutzungsangebots zu verpflichten, sondern weitergehend auch bereits die Geltung eines Mitnutzungsvertrags verbindlich anzuordnen. Die diesbezügliche Praxis der Bundesnetzagentur[11]Bundesnetzagentur, Beschl. v. 30.9.2019 – Az. BK11-19/007, Rn. 136 ff. wäre damit bestätigt.
Ein interessanter Fingerzeig der obersten Verwaltungsrichter:innen findet sich schließlich in den Ausführungen zum Regelungsgehalt einer Verpflichtung zur Angebotsabgabe. Dort ist vom „Nichteingreifen eines der in § 142 Abs. 2 TKG normierten Versagungsgründe“ als Vorfrage für den Erlass einer Anordnung auf Angebotsabgabe die Rede (Rn. 18). Dieses Nichteingreifen wird dann jedoch über die Formulierung „bzw. der nicht fristgemäße Nachweis des Vorliegens eines Versagungsgrundes“ relativiert. Das könnte darauf hindeuten, dass nach Auffassung des BVerwG ein Versagungsgrund nach § 142 Abs. 2 TKG einer Verpflichtung zur Abgabe eines Mitnutzungsangebots (bzw. letzten Endes eben auch zur Gewährung der Mitnutzung selbst) nur dann entgegensteht, wenn er fristgemäß nachgewiesen wird. Diese Frage ist bislang umstritten.[12]Vgl. VG Köln, Urt. v. 24.5.2024 – Az. 1 K 5359/23, Rn. 73 (NRWE).
Ein solches Verständnis erscheint ohne weiteres gerechtfertigt, wo es um Versagungsgründe geht, deren Geltendmachung allein die Entscheidungssphäre des Versorgungsunternehmens betrifft. Das gilt namentlich für das Vorliegen tragfähiger Alternativen oder auch den Überbau bestehender Glasfasernetze (§ 141 Abs. 2 Nr. 6 und 7 TKG). Es erscheint jedoch bereits dann schwierig, wenn der Versagungsgrund auf objektiven Begrenzungen beruht, wie der fehlenden technischen Eignung für die Unterbringung der Komponenten des Telekommunikationsnetzen (§ 141 Abs. 2 Nr. 1 TKG). Denn auch wenn das Versorgungsunternehmen diesen Einwand nicht fristgerecht erhebt, ändert dies nichts daran, dass das Zugangsobjekt ungeeignet ist. Erst recht gelten diese Bedenken, wenn die Versagungsgründe an Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder kritische Infrastrukturen anknüpfen. Es wäre ein seltsames Ergebnis, müssten solche Gefahren hingenommen werden, nur weil das Versorgungsunternehmen den entsprechenden Einwand nicht fristgemäß erhoben hat, seiner diesbezüglichen Darlegungslast dann aber zu einem späteren Zeitpunkt – etwa im Streitbeilegungs- oder im Gerichtsverfahren – nachkommt. Insoweit spricht viel dafür, jedenfalls in diesen Fällen das Bestehen eines Mitnutzungsanspruchs allein am objektiven Vorliegen des Versagungsgrunds zu messen (und das Telekommunikationsunternehmen gegebenenfalls auf einen Schadensersatzanspruch zu verweisen). Hier besteht daher noch weiterer rechtlicher Klärungsbedarf.
Ob den Ausführungen des BVerwG längerfristige Bedeutung zukommt, wird sich darüber hinaus ohnehin erst noch zeigen müssen. Denn das Telekommunikationsrecht des Netzausbaus steht vor einer grundlegenden Reform. Ab dem 12. November 2025 wird nämlich die Gigabit-Infrastrukturverordnung (EU) 2024/1309 als Nachfolgeregelung der Kostensenkungsrichtlinie 2014/61/EU in ihren wesentlichen Teilen gelten (Art. 19 Abs. 2 der Verordnung). Das Netzausbaurecht wird dann eine unmittelbare unionsrechtliche Grundlage haben, so dass die relevanten Vorschriften des TKG bis dahin angepasst bzw. auf eine ergänzende Funktion reduziert werden müssen. Damit werden sich eventuell auch neue Auslegungsfragen stellen, selbst dort, wo das BVerwG nun für das deutsche Recht klärende Feststellungen getroffen hat.
Fußnoten